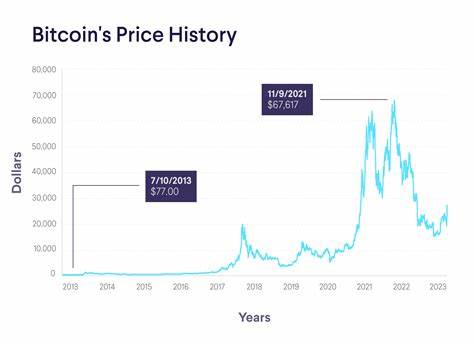Mit dem raschen Voranschreiten der Energiewende und dem stetigen Ausbau erneuerbarer Energiequellen gewinnen Batteriespeichersysteme immer mehr an Bedeutung. Sie sind zu einem integralen Bestandteil moderner Energiesysteme geworden und sichern insbesondere dort die Versorgung, wo Erzeugung und Verbrauch zeitlich auseinanderfallen. Trotz ihres vergleichsweise jungen Alters im Bereich der Energietechnologien sind Batteriespeicher inzwischen unverzichtbar für die Stabilisierung von Stromnetzen und für die Maximierung des Anteils grüner Energiequellen. Ein Batteriespeichersystem, allgemein als BESS (Battery Energy Storage System) bezeichnet, nutzt eine Reihe von Batterien, die zusammenarbeiten, um elektrische Energie zu speichern und bei Bedarf wieder abzugeben. Anders als konventionelle Kraftwerke, die meist auf fossilen Brennstoffen basieren, erfordern BESS keine ständige Brennstoffzufuhr, verfügen über eine kompakte Bauweise und können unkompliziert auch in urbanen Gebieten installiert werden.
Die Fähigkeit, innerhalb von Sekundenbruchteilen von einem Standby-Modus in den Vollbetrieb zu wechseln, macht Batteriespeicher zur schnellsten verfügbaren, steuerbaren Energiequelle auf modernen Stromnetzen. Die Einsatzgebiete von Batteriespeichersystemen sind vielfältig. Neben der kurzzeitigen Spitzenlastabdeckung, dem sogenannten Peak-Shaving, übernehmen sie wichtige Aufgaben in der Netzstabilisierung. Sie tragen zur Frequenzhaltung bei, sorgen für Spannungsstabilität und verhindern durch schnelle Reaktion potentiell gefährliche Netzinstabilitäten, die zu Stromausfällen führen können. Dies ist insbesondere in Regionen wichtig, in denen das Stromnetz bereits an seine Kapazitätsgrenzen stößt oder in denen eine hohe Einspeisung volatiler erneuerbarer Energien den Netzbetrieb erschwert.
Durch eine dezentrale Verteilung kleinerer Batteriespeicher lässt sich zudem eine größere Ausfallsicherheit und Flexibilität erreichen, während große Batteriespeicherkraftwerke besonders dort Sinn machen, wo erhebliche Energiemengen kurzfristig bereitgestellt werden müssen. Technologisch hat sich die Batterieentwicklung stark gewandelt. Während in den 1980er-Jahren noch vor allem Blei-Säure-Batterien zum Einsatz kamen, prägen heute Lithium-Ionen-Batterien den Markt der Großspeicher. Die Lithium-Ionen-Technologie zeichnet sich durch hohe Energiedichte, geringe Selbstentladung und lange Lebensdauer aus. Allerdings sind Sicherheitsaspekte wie Brand- und Explosionsrisiken nicht zu vernachlässigen, weshalb intensive Forschung betrieben wird, um die Betriebssicherheit zu verbessern und etwaige Gefahren durch technologische Weiterentwicklungen und verbesserte Überwachungssysteme zu minimieren.
Neue Batteriechemien, allen voran die Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP), gewinnen zunehmend an Bedeutung. Sie bieten Vorteile bei Sicherheit, Lebensdauer und Ressourcenverfügbarkeit und gelten daher als vielversprechende Alternative zu klassischen Lithium-Cobaltoxid-Batterien. Auch Natriumbasierte Batterien, beispielsweise Natrium-Ionen- oder Natrium-Schwefel-Batterien, rücken als kostengünstige und gut verfügbare Alternativen immer mehr in den Fokus. Diese Technologien sind insbesondere für Anwendungen attraktiv, bei denen Sicherheit und Kosten eine entscheidende Rolle spielen. Die Konstruktion von Batteriespeicheranlagen erfordert neben den Batterieeinheiten vor allem ein ausgefeiltes Energiemanagement und Leistungselektronik.
Durch Inverter wird die für Speicher typische Gleichspannung in netzkonformen Wechselstrom umgewandelt. Zusätzlich sind Schutz- und Steuerungssysteme notwendig, um einen stabilen und sicheren Anlagenbetrieb zu gewährleisten. Die Integration von Batterien in bestehende Energienetze erfolgt häufig in Kombination mit bereits vorhandenen Kraftwerksstandorten oder erneuerbaren Erzeugungsanlagen, um die Synergien optimal zu nutzen und die Netzanschlusskosten zu minimieren. Marktentwicklung und wirtschaftliche Aspekte spielen eine wichtige Rolle für die Verbreitung von Batteriespeichern. Weltweit steigt die installierte Kapazität rasant, getrieben durch fallende Kosten insbesondere der Lithium-Ionen-Technologie.
Seit 2014 halbieren sich die Kosten im Schnitt alle vier Jahre, und die Preise für Speicherkapazität erreichen mittlerweile Werte, die konventionelle Spitzenlastkraftwerke wie Gasturbinen oftmals wirtschaftlich überflügeln. Die zunehmende Elektrifizierung und der Ausbau der Elektromobilität treiben zudem die Nachfrage nach kostengünstigen und langlebigen Speicherlösungen weiter an. Während die größten Pumpspeicherwerke der Welt sowohl in Kapazität als auch in Leistung bei weitem noch über den aktuellen Batteriespeichersystemen liegen, überwiegen bei ersteren auch Einschränkungen wie Standortabhängigkeit, Umweltauflagen oder Bauzeiten. Batteriespeicher können flexibel dort installiert werden, wo sie benötigt werden, und bedienen mit hoher Reaktionsgeschwindigkeit vielfältige Anwendungen. Ein Blick auf die größten existierenden Batteriespeicheranlagen zeigt den Trend zu immer größeren und leistungsfähigeren Einheiten.
Projekte wie die in Moss Landing (Kalifornien), die mit mehreren Hundert Megawatt Leistung und im Gigawattstundenbereich speichert, demonstrieren den technologischen Fortschritt. Parallel befinden sich weltweit zahlreiche Großprojekte im Bau oder in Planung, die das Volumen und die Bedeutung von Batteriespeichern weiter steigern. Die Betriebssicherheit ist in der Praxis ein zentrales Thema. Obwohl die Anzahl der Zwischenfälle im Verhältnis zur Gesamtzahl der installierten Systeme gering ist und Sicherheitsstandards sowie Überwachungssysteme kontinuierlich verbessert werden, dokumentieren gelegentliche Brände und Ausfälle die Herausforderung. Hieraus ergeben sich weitere Forschungsinitiativen zur Brandvermeidung sowie zur Entwicklung von sicheren Batteriebauarten und -managementsystemen.
Die Betriebseigenschaften von Batteriespeichern sind wegen des Fehlens mechanischer Teile besonders vorteilhaft. Sie bieten extrem schnelle Reaktionszeiten und können so selbst kleinste Netzschwankungen ausgleichen – das ist eine wertvolle Eigenschaft vor allem bei der Integration erneuerbarer Energien mit volatiler Einspeisung. Neben der Frequenzregelung und Spannungshaltung übernehmen sie zunehmend Aufgaben wie das sogenannte Transmissionsverstärken, bei dem lokal Differenzen zwischen Angebot und Nachfrage ausgeglichen werden. In Zukunft wird mit einer weiteren Kostenreduktion, technologischem Fortschritt und verbesserten Geschäftsmodellen gerechnet, die Batteriespeichersysteme noch attraktiver machen. Die Einbindung von Second-Life-Batterien aus Elektrofahrzeugen als kostengünstige Speicheroption wird derzeit erprobt, wobei die Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit solcher Lösungen vom Preisverfall neuer Batterien beeinflusst wird.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Batteriespeichersysteme die Energielandschaft nachhaltig verändern. Sie erhöhen die Flexibilität und Stabilität der Netze, fördern den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien und tragen dazu bei, die Energiewende bezahlbar und verlässlich zu gestalten. Mit fortschreitender Technologie und wachsender Marktpräsenz werden sie künftig eine Schlüsselrolle im Energiesystem spielen, die Nachfrage nach nachhaltiger, sicherer und effizienter Stromversorgung auf nationaler und internationaler Ebene bedienen und so maßgeblich den Übergang zu einer klimafreundlichen Energiezukunft unterstützen.