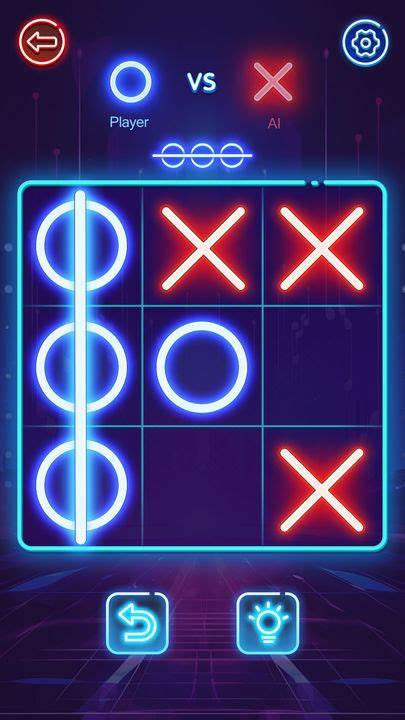Ein gesunder Lebensstil mit regelmäßiger Bewegung gilt allgemein als essenziell für das Herz-Kreislauf-System. Zahlreiche Studien zeigen, dass körperliche Aktivität das Risiko für Herzkrankheiten reduziert, das Gewicht reguliert und die allgemeine Fitness verbessert. Doch wie wirkt sich ein sehr hohes Trainingsvolumen, insbesondere bei Ausdauersportlern, auf die koronare Gesundheit aus? Neuere Forschungsergebnisse legen nahe, dass intensive Trainingsmengen mit einer Zunahme von Verkalkungen in den Herzkranzgefäßen verbunden sein könnten, was Fragen zum Risiko und Nutzen solcher Belastungen aufwirft. Die koronare Arterienverkalkung (Coronary Artery Calcification, kurz CAC) beschreibt Ablagerungen von Kalzium in den Wänden der Herzkranzgefäße. Solche Verkalkungen sind Marker für atherosklerotische Plaques, die zu Verengungen der Gefäße führen können und somit das Risiko für Herzinfarkte erhöhen.
Die Höhe des CAC-Scores, gemessen mittels Computertomographie, ist ein etablierter Indikator für das Vorhandensein subklinischer koronarer Herzerkrankungen. Eine umfassende Analyse mehrerer Beobachtungsstudien mit über 61.000 Teilnehmern hat kürzlich Licht auf den Zusammenhang zwischen Trainingsvolumen und CAC-Werten geworfen. Insbesondere bei männlichen Ausdauersportlern, die mehr als 3.000 MET-Minuten pro Woche an Training erreichen, wurde eine signifikant höhere mittlere CAC-Score im Vergleich zu männlichen Nicht-Sportlern festgestellt.
MET-Minuten (Metabolic Equivalent of Task) sind eine Maßeinheit für die körperliche Aktivität, die sowohl Intensität als auch Dauer berücksichtigt. Zum Vergleich entspricht 3.000 MET-Minuten in etwa fünf Stunden intensivem Ausdauertraining pro Woche. Interessanterweise zeigte sich dieser Effekt nicht bei männlichen Sportlern mit moderatem Trainingsvolumen zwischen 1.500 und 3.
000 MET-Minuten pro Woche und auch nicht bei weiblichen Athletinnen mit mindestens 1.500 MET-Minuten wöchentlich. Die Ergebnisse deuten somit auf eine geschlechtsspezifische Differenz hin, wobei Männer offenbar anfälliger für eine Zunahme von calcifizierten Plaques durch sehr hohe Belastungen zu sein scheinen. Die Ursachen hinter dieser Verkalkung bei intensivem Training sind bislang noch nicht abschließend geklärt. Mögliche Erklärungen umfassen eine Beanspruchung der Arterienwände durch wiederholte starke Belastungen, die zu mikroinflammatorischen Prozessen und kalzifizierenden Reparaturmechanismen führen könnten.
Auch hormonelle und genetische Faktoren spielen möglicherweise eine Rolle. Dennoch bleibt offen, ob diese erhöhten CAC-Werte bei trainierten Männern tatsächlich mit einem höheren Risiko für akute kardiovaskuläre Ereignisse verbunden sind oder ob es sich um eine stabilere, weniger gefährliche Form der Plaque handelt. Es ist wichtig zu erwähnen, dass intensive Bewegung insgesamt viele positive Effekte auf das Herz-Kreislauf-System hat. So verbessert Ausdauertraining die Herzmuskelkraft, senkt den Blutdruck, reduziert das LDL-Cholesterin und verbessert die Insulinsensitivität. Zudem helfen lange Jahre regelmäßigen Trainings, das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und plötzlichen Herztod signifikant zu senken.
Der Fund einer erhöhten koronaren Kalkablagerung bei sehr aktiven Männern bedeutet daher keineswegs, dass intensives Training grundsätzlich schädlich ist. Weitere Aspekte, die in der Forschung beleuchtet werden müssen, sind die Unterschiedlichkeit der Trainingsarten, die Dauer der sportlichen Karriere und die Beobachtungszeiträume. So ist unklar, ob sich die Verkalkungen nach dem Ende der intensiven Trainingsphase wieder zurückbilden oder ob sie sich im Laufe der Jahre sogar verstärken. Zudem ist die Rolle anderer Risikofaktoren wie Ernährung, Rauchen, Stress und genetischer Disposition zu berücksichtigen. Die Ergebnisse dieser Studien unterstreichen den Bedarf an qualitativ hochwertigen, langfristigen Untersuchungen, die den Einfluss von Trainingsvolumen, -intensität und -dauer differenzierter erfassen.
Dabei sollten sowohl Männer als auch Frauen sowie Sportler unterschiedlicher Disziplinen eingeschlossen werden, um die geschlechtsspezifischen Unterschiede besser zu verstehen und personifizierte Empfehlungen zu entwickeln. Für Leistungssportler und ambitionierte Freizeitsportler ist es daher sinnvoll, eng mit medizinischen Fachpersonen zusammenzuarbeiten, um die Herzgesundheit regelmäßig überwachen zu lassen. Methoden wie die koronare Computertomographie zur Messung des CAC-Scores, Echokardiographie, Belastungstests und Laborwerte bieten dabei eine umfassende Beurteilung. Auf Basis dieser Untersuchungen können Trainingspläne angepasst und mögliche Risiken frühzeitig erkannt werden. Zusammenfassend zeigt die Forschung, dass ein sehr hohes Trainingsvolumen bei männlichen Ausdauersportlern mit einer erhöhten koronaren Verkalkung korreliert, wobei die Folgen für die Herzgesundheit und das Langzeitrisiko noch nicht abschließend geklärt sind.
Für körperlich aktive Menschen bedeutet dies jedoch nicht, dass sie weniger trainieren sollten, sondern dass die Art, Intensität und Menge des Trainings individuell auf die persönliche Gesundheit abgestimmt werden sollten. Moderate bis intensive regelmäßige Bewegung bleibt eine der effektivsten Maßnahmen zur Förderung der Herz-Kreislauf-Gesundheit und zur Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen. Zukünftige Forschungsarbeiten werden helfen, die optimale Trainingsdosis zu definieren, die einerseits die Leistungsfähigkeit steigert und die gesundheitlichen Vorteile maximiert, andererseits aber potenzielle Risiken minimiert. Bis dahin ist es ratsam, den Trainingsumfang mit Bedacht und in Kombination mit einer gesunden Lebensweise zu wählen.