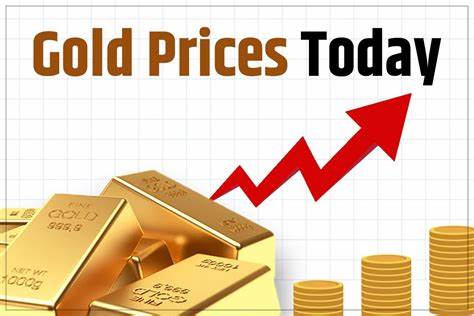Die aktuelle politische Landschaft im Bereich der Wissenschaft und Forschung erlebt eine intensive und teils kontroverse Phase, insbesondere im transatlantischen Verhältnis zwischen Europa und den Vereinigten Staaten. Im Zentrum der Debatte stehen die kritischen Anmerkungen der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, die Donald Trumps radikale Veränderungen in der US-Hochschulpolitik als eine „gigantische Fehleinschätzung“ verurteilen. Dabei setzen beide führenden Persönlichkeiten auf die Stärkung der europäischen Wissenschaft und wissenschaftlichen Zusammenarbeit, um ein Zeichen gegen die zunehmende Einschränkung der Freiheit und Förderung von Forschung in den USA zu setzen. Von der Leyen und Macron äußerten sich bei einer gemeinsamen Veranstaltung an der renommierten Sorbonne Universität in Paris, einem Ort, der für seine Tradition in Wissenschaft und Bildung steht. Hier wurde die neue Initiative „Choose Europe for Science“ vorgestellt, die von 2025 bis 2027 europäische Anreize schaffen soll, um Spitzenforscher aus aller Welt anzuziehen und Europa als internationalen Hotspot für wissenschaftliche Exzellenz zu etablieren.
Dabei stellt die Europäische Kommission ein Budget von 500 Millionen Euro bereit, ergänzt durch Frankreichs zusätzliche Mittel in Höhe von 100 Millionen Euro aus dem Programm „France 2030“. Die politischen Hintergründe dieser Initiative sind eng mit der Kritik an den Entwicklungen in den USA verknüpft. Unter der Regierung von Donald Trump wurde der akademische Bereich durch massive Einschnitte in Forschungsetats und eine restriktive Visa-Politik stark belastet. Diese Maßnahmen zielen besonders auf Universitäten und Forschungseinrichtungen ab, die als konservativ-kritisch gegenüber Trumps Politik wahrgenommen werden. Trumps Ansatz führte zu einem spürbaren Rückgang der internationalen Kooperationen und drohte, die Stellung der USA als führende Forschungsnation zu gefährden.
Von der Leyen sprach in ihrer Rede insbesondere die fundamentale Bedeutung von freier und offener Forschung an: „Die Rolle der Wissenschaft in unserer heutigen Welt wird infrage gestellt. Die Investition in fundamentale, freie und offene Forschung wird angezweifelt. Was für eine gigantische Fehleinschätzung.“ Sie betonte, dass Wissenschaft unabhängig von Nationalität, Geschlecht oder politischer Zugehörigkeit sein müsse. Diese Werte spiegeln sich auch in der geplanten Gesetzgebung wider, mit der die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung innerhalb der EU gesetzlich verankert werden soll, etwa durch den „European Research Area Act“.
Auch Präsident Macron zeigte sich in seiner Ansprache äußerst kritisch gegenüber den Entwicklungen in den USA. Er warnte davor, dass kein großes demokratisches Land Forschungseinrichtungen aufgrund von Vielfalt und Offenheit abwerten oder Forschenden die Einreise verwehren dürfe. Macron verwies außerdem auf die negative Wirkung einer solchen Politik auf den wissenschaftlichen Fortschritt und die demokratischen Werte insgesamt. Er bezeichnete Europa als „sicheren Hafen“ für Forschende, der trotz Herausforderungen Freiheit und Respekt vor wissenschaftlicher Arbeit garantiere. Die französische Initiative „Choose France for Science“, die bereits im Vormonat lanciert wurde, verfolgt ähnliche Ziele, um Forschende mit attraktiven Programmen und guten Arbeitsbedingungen nach Frankreich zu locken.
Trotz anfänglicher Kritik von französischen Wissenschaftlern über unzureichende Gehälter und Arbeitsbedingungen wird das Programm bislang mit Interesse aufgenommen, mit mehreren Hundert Bewerbungen. Dieses Engagement reflektiert den wachsenden Wettbewerb auf dem globalen Forschungsmarkt, insbesondere gegenüber den USA, wo viele Wissenschaftler sich zunehmend zwischen politischen Einschränkungen und Suche nach Fördermöglichkeiten entscheiden müssen. Doch Europa will nicht nur Talente anziehen, sondern auch die Innovationskraft stärken. In diesem Zusammenhang kündigte Ursula von der Leyen den Vorschlag des „European Innovation Act“ an, der bürokratische Hindernisse reduzieren und den Zugang zu Risikokapital erleichtern soll. Dies soll verhindern, dass bahnbrechende wissenschaftliche Entdeckungen nicht in unternehmerischen Erfolg umgemünzt werden können.
Weiterhin unterstützt die Kommission Strategien zur Förderung von Startups und wachstumsstarken Unternehmen, um Forschung aus den Laboren rasch für den Markt nutzbar zu machen. Finanzielle Investitionen in die Forschung werden von beiden Seiten der Ärmelkanalküste als Schlüsselfaktor für die Zukunft gesehen. Von der Leyen appellierte an die EU-Mitgliedstaaten, bis 2030 mindestens drei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts in Forschung und Entwicklung zu investieren. Dieses Ziel verfolgt die Europäische Union schon seit Jahren, konnte jedoch bislang nicht flächendeckend erreicht werden. Eine umfassende Steigerung der Ausgaben ist essenziell, um mit den USA und China im globalen Innovationswettbewerb Schritt zu halten.
Besonders bemerkenswert ist die symbolische Rückbesinnung auf historische Persönlichkeiten wie Marie Curie, die mehrfach Nobelpreise für ihre radikalen Entdeckungen erhielt. Curie gilt als Beispiel für die grenzüberschreitende Natur wissenschaftlicher Exzellenz – sie floh aus Polen nach Frankreich und brachte so bedeutende Forschungen hervor. Ihre Geschichte wurde von von der Leyen genutzt, um die integrative und offene Haltung Europas gegenüber Forschenden weltweit zu unterstreichen. Die Ankündigungen und kritischen Worte von von der Leyen und Macron illustrieren einen grundlegenden Unterschied in der Sichtweise auf Wissenschaftspolitik zwischen Europa und den USA unter der Trump-Administration. Während die USA einzelne Bereiche der Hochschulbildung und Forschung politisch neu ausrichten und Gelder kürzen, positioniert sich Europa als Verteidiger von Wissenschaftsfreiheit, Diversität und Offenheit.
Die Auswirkungen dieser Konflikte betreffen weit mehr als nur akademische Institutionen. Innovationsfähigkeit, technologische Weiterentwicklung und globale Wettbewerbsfähigkeit sind direkt an eine funktionierende und gut ausgestattete Forschungslandschaft gekoppelt. Europa will hier mit seiner eigenen Strategie und klaren politischen Signalen nicht nur Forscher anlocken, sondern auch Grundlagen für nachhaltiges Wachstum und gesellschaftlichen Fortschritt legen. Insgesamt zeigen die aktuellen Entwicklungen, wie Wissenschaftspolitik zum Spiegel politischer Prioritäten und Werte wird. Die EU und Frankreich setzen auf internationaler Bühne ein Zeichen gegen Isolationismus und politische Restriktionen in der Forschung.



![Laid off again is tech worth it anymore? [video]](/images/A553AA14-1545-4B0F-BA79-C07D78EF8312)