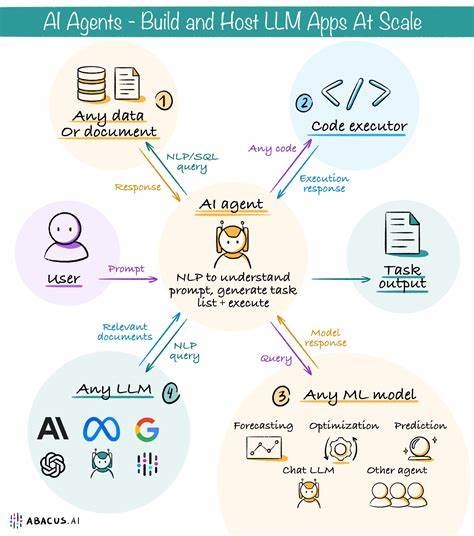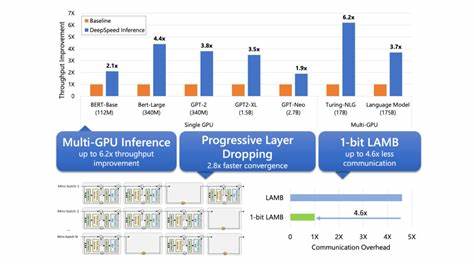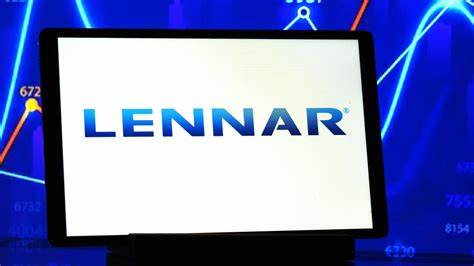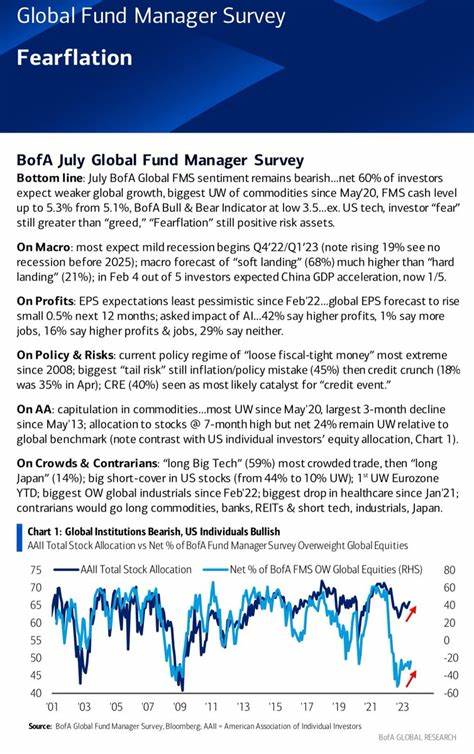Die Idee, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines Unternehmens unabhängig von Standort und Rolle das gleiche Gehalt zu zahlen, klingt auf den ersten Blick einfach und gerecht. Gerade bei kleinen Teams, die vollständig remote arbeiten, erscheint diese Methode als eine elegante Lösung, um Gehaltsdiskriminierung und komplizierte Verhandlungen zu vermeiden. Doch hinter der vermeintlichen Einfachheit verbergen sich zahlreiche Herausforderungen, die eine faire Umsetzung dieser Praxis erschweren können. Der Begriff „gleiches Gehalt“ ist alles andere als eindeutig und stellt Unternehmen vor eine Vielzahl von Fragen, die weit über die reine Vertragssumme hinausgehen. Ein zentraler Aspekt bei der Definition von gleichen Gehältern ist die Differenzierung zwischen dem nominal vereinbarten Bruttogehalt und den tatsächlichen Kosten, die ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin dem Unternehmen verursacht.
Beispielhaft lässt sich dies an einem deutschen Angestellten aufzeigen: Ein Vertrag über ein Jahresgehalt von 75.000 Euro bedeutet für den Arbeitgeber nicht automatisch die Zahlung dieser Summe. Vielmehr kommen Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung hinzu, sodass sich die Gesamtkosten für das Unternehmen auf beinahe 90.000 Euro erhöhen. Diese Zusatzkosten entstehen aus gesetzlichen Vorgaben und gelten für reguläre Angestellte in Deutschland.
Im Gegensatz dazu tragen beispielsweise Inhaber oder Geschäftsführer eines Unternehmens, die zugleich als CEO agieren, unter bestimmten Umständen geringere Lohnnebenkosten. In deutschen Firmen sind diese oft nicht gesetzlich verpflichtet, Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen. Das führt dazu, dass ein CEO mit einem vertraglich gleichen Gehalt von 75.000 Euro das Unternehmen lediglich diese Summe kostet, ohne zusätzliche Sozialabgaben. Die Situation wird noch komplexer, wenn Mitarbeiter in anderen Ländern beschäftigt sind.
Anders als Freelancer, bei denen klare Vertragskosten und Honorare vorliegen, variieren die tatsächlichen Arbeitgeberkosten bei Festangestellten weltweit stark. Unternehmen greifen häufig auf sogenannte „Employer of Record“-Dienstleister zurück. Diese übernehmen administrative Aufgaben, wie Gehaltsabrechnung und Einhaltung lokaler arbeitsrechtlicher Vorgaben, was jedoch zusätzliche monatliche Gebühren verursacht. Alleine dieser Verwaltungsprozess kann die Kosten für die Mitarbeiter erheblich in die Höhe treiben – im Fall von Spanien zum Beispiel kann ein vereinbartes Gehalt von 75.000 Euro schnell auf etwa 100.
000 Euro Unternehmensaufwand steigen. Neben den Gebühren für den Dienstleister kommen in Spanien gesetzliche Besonderheiten wie der Anspruch auf ein 13. und sogar ein 14. Monatsgehalt hinzu. Diese Unterschiede werfen die Frage auf, was eigentlich als „gleiches Gehalt“ zu verstehen ist.
Betrachtet man rein das Vertragsgehalt, so herrscht Gleichheit. Doch aus Sicht der Unternehmenskasse, die jeden Monat echte Ausgaben tätigen muss, existieren erhebliche Unterschiede. Diejenigen, die auf die Vertragszahlen schauen, könnten das Modell als fair bewerten, während die Verantwortlichen für Budget und Finanzen durchaus eine andere Perspektive haben. Sollte „Gleichheit“ dann eher bei den Arbeitgeberkosten ansetzen, um ein faireres Bild zu erzeugen, so müssten infolgedessen die Aufwände für Freelancer, CEOs und verschieden international beschäftigte Mitarbeiter in der Gehaltsgestaltung berücksichtigt werden. Allerdings entsteht an dieser Stelle ein Teufelskreis.
Erhöht man etwa das Honorar für Freelancer oder CEOs, um die Gleichheit der Kosten herzustellen, entsteht gegebenenfalls Unmut bei Mitarbeitern, die höhere soziale Leistungen und andere gesetzliche Vorteile genießen, ohne dass diese unmittelbar im Gehalt erkennbar sind. Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft zusätzliche soziale und steuerliche Leistungen, die stark regional unterschiedlich ausfallen können. In Deutschland etwa sind Arbeitgeberleistungen zur Krankenversicherung Teil der Gesamtkosten für Beschäftigte. In anderen Ländern hingegen müssen Mitarbeiter ihre Gesundheitsversorgung häufig privat organisieren, was wiederum Einfluss auf Gehaltsverhandlungen und Erwartungen hat. Steuern und Sozialversicherungsabgaben variieren stark je nach Land.
Ein Arbeitnehmer in Indien bezahlt beispielsweise möglicherweise weniger Einkommenssteuer als ein Kollege in Deutschland. Dies wirft die Frage auf, ob und wie Gehälter individuell angepasst werden sollten, um solche Differenzen auszugleichen. Auch Faktoren wie Urlaubstage und gesetzliche Feiertage sind nicht gleich verteilt. Ein deutscher Arbeitsplatz bietet im Durchschnitt deutlich mehr bezahlte freie Tage als viele andere Länder. Sollte ein internationales Unternehmen diese unterschiedlichen Standards für alle Mitarbeiter angleichen? Oder sollte die Urlaubspolitik jeweils an das jeweilige Landesmodell angepasst bleiben? Solche Überlegungen beeinflussen ebenfalls das Verständnis von Gehaltsgerechtigkeit.
Darüber hinaus entwickeln einige internationale Angestellte Strategien, um die Unternehmensstruktur zu optimieren und dadurch die Kosten für den Arbeitgeber zu senken. Beispielsweise kann eine spanische Fachkraft eine eigene Firma gründen, die dann mit dem eigentlichen Arbeitgeber abrechnet. Dies ist zwar legal, führt aber zu einem verzerrten Bild der tatsächlichen Kosten und Gehälter – wiederum ein Faktor, der bei der Betrachtung von Gehaltsgleichheit mitgedacht werden muss. Die Anwendung all dieser Überlegungen auf ein großes Unternehmen mit vielen Mitarbeitern in unterschiedlichen Ländern und mit verschiedenen Beschäftigungsmodellen gestaltet sich besonders kompliziert. Hier wäre es fast unmöglich, eine Gehaltsstruktur zu finden, die alle zufriedenstellt und gleichzeitig wirtschaftlich vertretbar ist.
In kleinen Teams hingegen erlaubt die enge Kommunikation oft ein „Fühlen“ für eine akzeptable Lösung zu entwickeln. Wenn die Gehaltsstruktur transparent gemacht wird, alle Seiten den Entscheidungsprozess verstehen und sich auf eine einigermaßen faire Basis einigen, führt dies oft zu hoher Zufriedenheit und kann eine Grundlage für kollaboratives Arbeiten bilden. Letztlich öffnen sich hier nicht nur administrative oder steuerliche, sondern auch philosophische und kulturelle Fragen. Geht es um Leistung und individuelle Beiträge? Oder steht Solidarität und Gleichbehandlung im Vordergrund? Sollen unterschiedliche Lebenshaltungskosten oder lokale Rechtssysteme berücksichtigt werden? Auch die persönliche Situation der Mitarbeiter fließt unweigerlich mit ein. Ist es überhaupt möglich, einen global gültigen Standard für „gleiche Gehälter“ zu definieren? Oder ist das Konzept per se, angesichts der Vielfalt von Lebensrealitäten und Rahmenbedingungen, zum Scheitern verurteilt? Einige Experten plädieren für flexible Gehaltsmodelle, die einerseits Einheitlichkeit fördern und andererseits die Einzigartigkeit und Bedürfnisse einzelner berücksichtigen.
Andere bevorzugen eine Vereinheitlichung allein auf Vertragsbasis, um Transparenz und Einfachheit zu gewährleisten. Für einige Firmen sind Zahlungen nach Lebenshaltungskosten und lokalen Marktgegebenheiten der pragmatischste Weg. Doch dies kann durch die zunehmende Mobilität und den Wunsch von Remote-Mitarbeitern, ihren Lebensmittelpunkt zu verändern, erschwert werden. Jemand mit Vertrag in Berlin, der jedoch dauerhaft in Indien lebt, bringt etwa ethische wie praktische Herausforderungen mit sich. Die Diskussion zeigt, dass „gleiche Gehälter“ mehr sind als nur eine simplifizierte Zahl auf einem Arbeitsvertrag.
Stattdessen ist es ein komplexes Geflecht aus finanziellen, rechtlichen und sozialen Faktoren, die im Kontext verschiedenster globaler Arbeitsmodelle betrachtet werden müssen. Das wichtigste dabei scheint, offen und ehrlich mit allen Beteiligten zu kommunizieren, transparent darzulegen, wie Gehälter zustande kommen und akzeptierte Kompromisse zu finden. Gerade in kleinen, agilen Unternehmen kann dieses Vorgehen langfristig zu mehr Vertrauen, Zusammenhalt und einer hohen Motivation der Mitarbeitenden führen. In Zukunft wird das Thema sicherlich noch an Bedeutung gewinnen, wenn sich die Arbeitswelt weiter globalisiert und die Remote-Arbeit noch stärker verbreitet. Unternehmen, die es schaffen, ihre Gehaltsstrukturen klar und fair zu gestalten, werden bei der Gewinnung und Bindung von Talenten einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil haben.
Die Herausforderung besteht darin, die Balance zwischen Gleichheit, Fairness und Wirtschaftlichkeit stets neu zu justieren und den individuellen Umständen der Mitarbeitenden gerecht zu werden. Nur so wird das Konzept der gleichen Gehälter für Remote-Mitarbeiter seine volle Wirkung entfalten können.