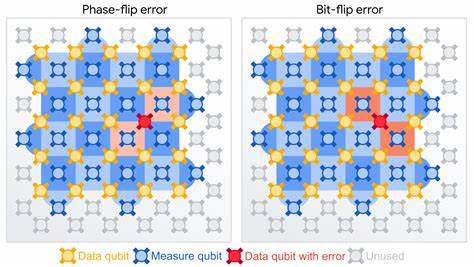In der heutigen digitalen Welt, in der Unternehmen zunehmend von IT-Systemen und Software abhängig sind, erscheint es unerlässlich, Ausfälle zu verhindern. Viele Organisationen investieren enorme Ressourcen in das Incident-Management, um Störungen zu minimieren oder gar vollständig auszuschließen. Doch eine bittere Wahrheit bleibt: Ihren letzten Ausfall werden Sie nicht verhindern können – egal wie viel Zeit und Mühe Sie investieren. Diese Einsicht ist nicht resignierend, sondern ein Ausgangspunkt für ein realistisches Verständnis von komplexen Systemen und für einen effektiveren Umgang mit Vorfällen. Jedes technische System ist ein komplexes Geflecht von Komponenten, Interaktionen und Abhängigkeiten, die sich ständig verändern und weiterentwickeln.
Ob es sich um Cloud-Anwendungen, verteilte Infrastrukturen oder monolithische Software handelt – die inhärente Komplexität macht es unmöglich, alle möglichen Fehlerquellen vorauszusehen oder auszuschließen. In der Praxis bedeutet das, dass auch beim besten Monitoring, modernsten Tools und erfahrenen Teams Fehler passieren werden, die zu Ausfällen führen. Viele Unternehmen richten ihren Fokus intuitiv auf die Schwere von Vorfällen. Die Annahme ist naheliegend: Je schwerwiegender ein Ausfall, desto größer die Aufmerksamkeit und der Aufwand bei der anschließenden Analyse und Problemlösung. Der Gedanke dahinter ist, dass post-incident Maßnahmen dazu beitragen, ähnliche schwere Vorfälle in der Zukunft verhindern zu können.
Diese Logik klingt einleuchtend, doch wenn wir nüchtern auf die Realität schauen, zeigt sich eine andere Geschichte. Eine Betrachtung der vergangenen schweren Ausfälle in vielen Organisationen offenbart ein Muster: Die schwersten Vorfälle ähneln meist nicht den früheren, auch nicht denen, bei denen viel Aufwand in die Nachbereitung investiert wurde. Oft sind diese drastischen Ausfälle das Ergebnis einer unerwarteten Kombination von Faktoren und Wechselwirkungen, die keiner früheren Analyse entsprochen haben. Dies bestätigt die Theorie, dass Vorfälle nicht monokausal sind, sondern durch eine Vielzahl an Umständen entstehen, deren Interaktion komplex und oft nicht intuitiv vorhersehbar ist. Die Konsequenz daraus ist, dass das reine Gewicht oder die Schwere eines Vorfalls kein guter Indikator für den Wert der Nachbereitung ist.
Die Vorstellung, dass eine Stunde Arbeit an einem SEV0 (kritischster Ausfall) effektiver ist, um die Systemverfügbarkeit zu verbessern als eine Stunde Arbeit an einem SEV2 (geringerer Ausfall), hat sich empirisch nicht bewährt. Vielmehr bieten auch kleinere Vorfälle, sogenannte Near-Misses oder Beinahe-Ausfälle, wertvolle Einblicke in zugrundeliegende Schwachstellen oder Risiken, die oft übersehen werden. Gefahr geht nicht immer von offensichtlichen, großen Problemen aus. Gerade subtile und vermeintlich geringfügige Störungen können Hinweise auf systemische Risiken liefern, die bei Unterschätzung zu katastrophalen Ausfällen führen können. Ein professioneller Umgang mit Incident-Management muss deshalb auch die Fähigkeit fördern, Signale aus verschiedenen Quellen und Schweregraden zu erfassen, zu analysieren und entsprechend zu bewerten.
Neben der Betrachtung von Vorfällen selbst existieren weitere wertvolle Datenquellen, die dazu beitragen können, zukünftige Risiken besser zu verstehen und zu mindern. Dazu gehören Monitoring-Daten, Logs, Performance-Messungen, Nutzerfeedback und sogar externe Ereignisse, die indirekt Einfluss auf die Stabilität eines Systems haben können. Das Konstrukt „Severity“ allein ist hier zu eng gefasst. Angesichts begrenzter personeller und zeitlicher Ressourcen ist es unvermeidlich, Prioritäten im Umgang mit Vorfällen zu setzen. Doch diese Priorisierung sollte weniger an der reinen Schwere der Vorfälle orientiert sein, sondern vielmehr an der Frage, welche Erkenntnisse gewonnen werden können und wie sie das Gesamtrisiko am wirksamsten reduzieren.
Dabei muss auch berücksichtigt werden, dass einige systemische Risiken durch Investitionen in proaktive Maßnahmen deutlich besser adressiert werden als durch rein reaktives Post-Incident-Management. Die Erkenntnis, dass nicht der letzte Ausfall verhindert werden kann, sondern ein resilienter Umgang mit Ausfällen im Zentrum stehen muss, fordert ein grundlegendes Umdenken in Organisationen. Resilienz bedeutet, robust genug zu sein, um sich von Störungen schnell zu erholen, Schäden zu minimieren und den Betrieb schnellstmöglich wieder aufzunehmen. Ein resilientes Unternehmen setzt nicht ausschließlich auf Prävention, sondern auch auf schnelle Erkennung, effektive Intervention und ständige Lernprozesse. Dabei hilft eine Kultur, in der Vorfälle transparent kommuniziert und als Chance zur Verbesserung verstanden werden.
Fehler werden nicht als Makel gebrandmarkt, sondern kritisch hinterfragt und genutzt, um das System weiterzuentwickeln. Incident-Post-Mortems sollten demnach weniger eine Schuldzuweisung sein, sondern vor allem systemische Schwächen aufdecken und Handlungsempfehlungen liefern, die tatsächlich eine Risikoreduktion erzielen. Hierfür ist es wichtig, neue Denkweisen zur Ursachenfindung zu fördern und den Fokus von der Suche nach einzelnen Schuldigen auf das Erkennen von Mustern und komplexen Zusammenhängen zu legen. Eine weitere Praxis, die sich bewährt hat, ist die Einbeziehung von Near-Misses und kleineren Vorfällen in das Risikomanagement. Diese helfen dabei, potenzielle Kettenreaktionen frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen zu entwickeln, bevor größere Ausfälle auftreten.
Es geht um das Sammeln von Signalen und das frühzeitige Identifizieren von Anomalien. Abschließend zeigt sich, dass Ausfallprävention eine multidimensionale Herausforderung ist. Die Suche nach einer ultimativen Sicherheit – dem Verhindern des letzten Ausfalls – ist ein Mythos. Allerdings eröffnet die Akzeptanz dieser Realität die Möglichkeit, Strategien zu entwickeln, die bessere Ergebnisse liefern: Strategien, die Komplexität anerkennen, aus vielfältigen Datenquellen lernen und eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung fördern. In einer Welt, in der Ausfälle unvermeidbar sind, kann der Fokus auf Resilienz, schnelle Reaktion und ganzheitliches Risikomanagement den entscheidenden Unterschied machen.
Organisationen, die das verinnerlichen, werden nicht nur schneller auf Störungen reagieren, sondern auch langfristig stabiler und erfolgreicher agieren.