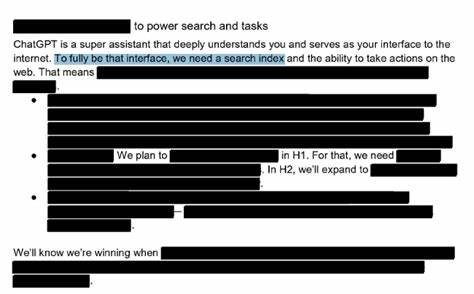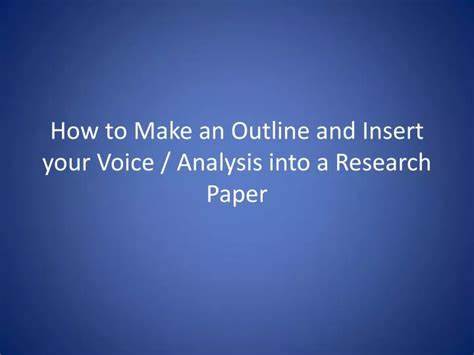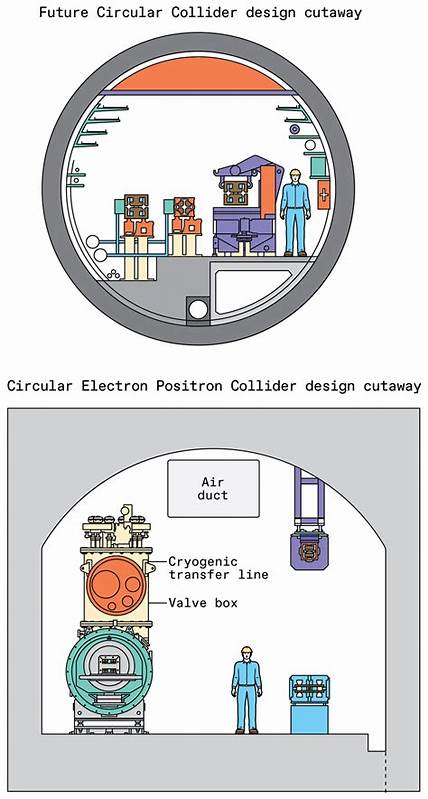Der Verkauf eines Startups ist für viele Gründer ein bedeutender Schritt, der weit über finanzielle Aspekte hinausgeht. Auch wenn es oft heißt, dass Startups gekauft und nicht verkauft werden, verbirgt sich hinter dieser Aussage eine komplexe Dynamik, die Verständnis und Vorbereitung seitens der Gründer erfordert. Ein M&A-Workshop, der speziell die Perspektive der Käufer beleuchtet, liefert dabei wertvolle Erkenntnisse, die helfen, den Exit-Prozess gezielt und erfolgreich zu gestalten. Die treibenden Kräfte hinter Akquisitionen von Startups sind vielschichtig und reichen von strategischen Zielen bis hin zu individuellen Motiven innerhalb der Kauforganisation. Dieses Verständnis ist essenziell, um sich als Gründer optimal zu positionieren und die Erfolgschancen beim Verkauf des eigenen Unternehmens zu maximieren.
Zu Beginn ist es entscheidend, dass Gründer ihre eigenen Ziele klar definieren und verstehen. Der Grund, warum ein Startup verkauft werden soll, beeinflusst maßgeblich den gesamten Prozess und die Auswahl potentieller Käufer. Einige möchten durch eine Akquisition neue Ressourcen und Marktmacht gewinnen, um im Wettbewerb zu bestehen. Andere sind erschöpft vom Druck endloser Finanzierungsrunden oder wollen eine Veränderung in der Eigentümerstruktur herbeiführen. Wiederum andere stehen vor einer finanziellen Grenze und möchten durch einen Verkauf flüssig werden, um neue Wege einzuschlagen.
Diese Unterschiedlichkeit der Zielsetzungen verlangt nach einer individuellen Strategie. Ohne klare Zielsetzung riskieren Gründer, sich in ungeeigneten Verhandlungen zu verlieren oder wichtige Chancen zu verpassen. Ein wichtiger Aspekt im Prozess ist das Überschneiden der Ziele von Käufer und Verkäufer. Übernahmen geschehen nicht zufällig, sondern sind Ergebnis einer Schnittmenge strategischer Interessen. Käufer suchen neben finanziellen Resultaten vor allem Lösungen für spezielle Herausforderungen in ihrem Geschäftsumfeld.
Ein Startup, das eine Lücke schließt oder Innovationen einbringt, wird als wertvoll betrachtet und somit zur attraktiven Übernahmekandidatin. Gründer sollten deshalb intensiv recherchieren, welche Bedürfnisse potenzielle Käufer haben und ihr Unternehmen als unverzichtbare Lösung positionieren. Eine proaktive Einstellung, bei der der Fokus auf die Bedürfnisse des Käufers gelegt wird, erhöht die Wahrscheinlichkeit, den Prozess zu steuern und das Geschäft erfolgreich zu verhandeln. Dabei ist es ein Trugschluss zu glauben, dass finanzielle Kennzahlen wie Umsatz und Gewinn allein den Wert eines Startups bestimmen. Die Praxis zeigt immer wieder, dass Unternehmen, die kaum oder gar keinen Umsatz vorweisen, für große Konzerne äußerst interessant sein können.
Ein prominentes Beispiel ist die Übernahme von Instagram durch Facebook, als Instagram noch in den Kinderschuhen steckte und kaum Umsätze erzielte. Der Erwerb erfolgte vielmehr aufgrund des hohen Potenzials sowie der zugrundeliegenden Technologie und des talentierten Teams. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der milliardenschweren Übernahme von io durch OpenAI – das Startup hatte ein eigenständiges Team und einzigartige Fähigkeiten, nicht etwa eine lange Umsatzhistorie. Das bedeutet, dass Gründer den Wert ihres Startups nicht nur in Zahlen messen, sondern auch die immateriellen Werte wie technologische Kompetenz, Nutzerbasis, Innovationskraft oder das Talent einzelner Mitarbeiter herausarbeiten müssen, um diesen für externe Investoren sichtbar zu machen. Das Thema Wertschöpfung in M&A-Situationen reicht aber noch tiefer.
Wert entsteht nicht nur auf der Ebene der Organisation, sondern auch auf der individuellen Ebene innerhalb der Käuferfirma. Während oberflächlich oft strategische Überlegungen dominieren, spielen persönliche Motivationen und interne Machtkonstellationen eine ebenso große Rolle. In den Gesprächen mit Entscheidungsträgern wird man meist formal begründete Interessen hören, doch im Hintergrund können persönliche Ziele wie Karriereaussichten, interne Wettbewerbsverhältnisse oder auch Abneigungen gegenüber bestimmten Projekten den Ausgang von Verhandlungen stark beeinflussen. Dieses vielschichtige Geflecht macht es für Gründer herausfordernd, den Erfolg einer Akquisition vorherzusagen. Ein tiefgehendes Verständnis für interne Dynamiken beim Käufer kann jedoch entscheidend sein, um den Prozess positiv zu beeinflussen oder richtige Ansprechpartner zu identifizieren.
Ein weiteres elementares Thema, das Käufer im M&A-Prozess umtreibt, ist die Frage nach „Buy vs. Build“. Große Organisationen stehen immer wieder vor der Herausforderung, ob sie Leistungen und Technologien lieber intern entwickeln oder durch Zukauf erwerben sollten. Oft scheint auf den ersten Blick der Aufbau eigener Lösungen naheliegend – schließlich verfügen viele etablierte Unternehmen über das nötige Kapital und die Talente. Doch in der Praxis entscheiden sich viele dazu, gezielt Startups zu kaufen, da diese schnelle Markteintritt ermöglichen, Risiken minimieren und bereits eine treue Kundenbasis besitzen.
Ein Vorzeigeprojekt ist hier die Übernahme von Runna durch Strava, die sich gegen eine Eigenentwicklung entschieden, um schnell ein ausgereiftes Produkt mit relevanter Nutzer-Community zu gewinnen. Diese strategische Entscheidung spricht für die Bedeutung von Geschwindigkeit und Marktpositionierung in einem umkämpften Umfeld, bei der eine Akquisition oft die bessere Wahl gegenüber mühsamer interner Entwicklung ist. Auf Seiten der Gründer stellt sich dann die Frage, wie die richtige Ansprache und Beziehungspflege mit potenziellen Käufern aussehen sollte. Hier gibt es zwei unterschiedliche Herangehensweisen: Top-down oder Bottom-up Engagement. Beide haben ihre Vorteile und Fallen.
Ein direkter Zugang zu Führungsetagen wie Vorstand, Geschäftsführung oder strategischen Abteilungen kann schnelle Entscheidungen herbeiführen und strategische Interessensvertretung sichern. Ohne Unterstützung der operativen Einheiten, die später die Integration umsetzen, drohen jedoch Widerstände und Verzögerungen. Umgekehrt kann die Unterstützung auf operativer Ebene eine wertvolle Basis bieten und nachhaltige Nutzung des Produkts sichern. Allerdings droht ein Mangel an strategischer Rückendeckung, was den Deal blockieren kann. Deshalb empfehlen Experten eine parallele Beziehungspflege auf allen Ebenen, um sowohl strategische als auch operative Akteure als Fürsprecher zu gewinnen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass erfolgreiche Startup-Übernahmen auf einem klaren Verständnis sowohl der eigenen Ziele als Gründer als auch der Beweggründe und Bedürfnisse möglicher Käufer basieren. Von großer Bedeutung ist es, nicht nur finanzielle Leistungskennzahlen zu betrachten, sondern auch den immateriellen Wert des Startups herauszuarbeiten. Zudem spielen persönliche Motivationen innerhalb der Käuferorganisation eine nicht zu unterschätzende Rolle. Die Entscheidung eines Käufers, das Startup zu erwerben statt selbst etwas zu entwickeln, zeigt die strategische Orientierung auf Schnelllebigkeit, Risikoabschwächung und den sofortigen Zugang zu Marktressourcen. Die Ansprache potenzieller Käufer sollte dabei nicht nur auf einer Ebene erfolgen, sondern sowohl auf Top-Down- als auch Bottom-Up-Ebene stattfinden, um interne Unterstützung sicherzustellen.
Gleichzeitig gilt es, sichtbar und präsent in relevanten Märkten und Gesprächen zu sein. Nicht selten verpassen gute Unternehmen ihre Gelegenheit, weil sie zeitlich nicht vorbereitet sind oder ihre Leistung nicht konsequent unter Beweis stellen. Die aktive Beziehungspflege mit potenziellen Käufern in der frühen Phase erhöht die Chancen, als strategisch wichtige Lösung wahrgenommen zu werden. Letztendlich führt die Kombination aus Wertschöpfung und Sichtbarkeit zu einem hohen Interesse bei Käufern, ermöglicht höhere Bewertungen und schafft einen Exit, der sowohl Investoren als auch Gründer zufriedenstellt. Das Verständnis für den Käufer-Mindset in M&A-Prozessen ist somit ein wesentlicher Baustein auf dem Weg zu einer erfolgreichen Startup-Übernahme.
Gründer, die diese Dynamiken verinnerlichen, können ihre Unternehmen nicht nur wertvoller machen, sondern auch den Verhandlungsprozess selbstbewusster und zielorientierter gestalten. Die Vorbereitung auf einen Exit beginnt demnach lange vor dem ersten Gespräch – und zwar in der Entwicklung einer klaren Strategie, der klaren Kommunikation des mehrdimensionalen Unternehmenswerts sowie der gezielten Vernetzung mit relevanten Akteuren. Wer diese Aspekte beherzigt, ist für die Herausforderungen und Chancen von Startup-Übernahmen bestens gerüstet.