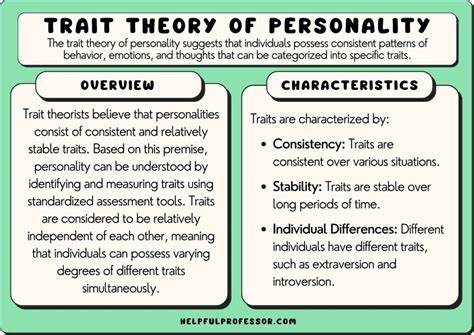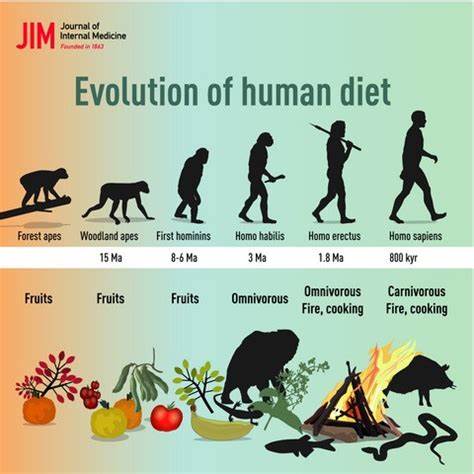Die Pandanus-Sprachen sind eine bemerkenswerte Erscheinung unter den Sprachen Neuguineas und gehören zu den ritualisierten Vermeidungssprachen, die im östlichen Hochland von Neuguinea von mehreren Völkern gepflegt werden. Sie sind eng mit der Ernte und Verarbeitung von Pandanus-Nüssen, genauer gesagt von Karuka-Nüssen (Pandanus julianettii und Pandanus brosimos), verbunden und stellen einen außergewöhnlichen sprachlichen Mechanismus dar, der sowohl den Umgang mit der Natur als auch tief verwurzelte kulturelle Glaubensvorstellungen widerspiegelt. Die Verwendung dieser Sprachen dient dabei nicht nur praktischen Zwecken, sondern wird von spirituellen Überzeugungen getragen, die den Respekt vor den Naturgeistern und den Schutz der Ernte sicherstellen sollen. Die faszinierende Kombination aus Sprachstruktur, Ritual und sozialer Funktion macht die Pandanus-Sprachen zu einem einzigartigen Forschungsgegenstand der Sprachwissenschaft und Ethnologie. Die Nutzung der Pandanus-Sprachen ist eng mit der Jahreszeit der Karuka-Ernte verknüpft.
Während die Gemeinschaften in sogenannten Tabubereichen campen, um die fetthaltigen Nüsse zu sammeln und zuzubereiten, ist es üblich, dass regulär verwendete Wörter, die normalerweise für die Beschreibung von Lebewesen, Pflanzen und bestimmten Handlungskonzepten gebraucht werden, als unangenehm oder gar schädlich für das Wachstum der Pflanzen betrachtet werden. Der Glaube, dass bestimmte Wörter magische oder negative Kräfte haben könnten, die das Wohlergehen der Nussbäume beeinträchtigen, führt dazu, dass ein vollständig alternatives Vokabular entwickelt wurde. Dieses umfasst bis zu tausend Wörter und spezielle Ausdrücke, die als Ersatz für die normalen Begriffe verwendet werden. Auf diese Weise entsteht eine elaborierte Sprache, die über Generationen hinweg tradiert wird und stetig Anpassungen erfährt, insbesondere wenn Wörter außerhalb des fest definierten Tabubereichs bekannt werden und somit ersetzt werden müssen. Die Bedeutung der Pandanus-Sprachen geht über die reine Kommunikation hinaus.
Sie sind ein Mittel zur Kontrolle der vermeintlichen magischen Eigenschaften der höheren Bergregionen, in denen die Karuka-Pflanzen wachsen. Die Einhaltung der sprachlichen Tabus wird als notwendig erachtet, um die guten Geister zu besänftigen und die Anwesenheit gefährlicher Naturwesen wie beispielsweise des sogenannten Kita-Menda, einem Ritual-Wächter der wilden Hunde, nicht herauszufordern. Die Angst, dass diese Geister beim falschen Gebrauch der regulären Sprache herabsteigen könnten, führt dazu, dass nur die speziell codierte Pandanus-Sprache in den Erntegebieten spricht. Dabei ist diese Praxis generationsübergreifend verankert: Sowohl Männer als auch Frauen aller Altersgruppen sollten die Pandanus-Sprache beherrschen, bevor sie sich in die genannten tabuisierten Bereiche begeben. Für Außenstehende, die die Sprache nicht beherrschen, wird jedoch häufig das breite Tok-Pisin als Ersatztugend geduldet.
Strukturell basieren die Pandanus-Sprachen auf den jeweiligen Muttersprachen der Völker wie Kewa, Imbongu, Kalam und anderen, weisen aber eine stark eingeschränkte Grammatik und ein spezielles Vokabular auf, das besonders bei der Nomenklatur lebender Organismen stark vereinfacht und konsolidiert ist. Dabei erfolgt häufig die Gruppierung von Wörtern unter sogenannten Oberbegriffen, die im normalen Sprachgebrauch nicht existieren und das Wissen über das gesellschaftlich akzeptierte Vokabular erweitern. Ein interessanter Aspekt ist die Nutzung von Fremdwörtern aus benachbarten Sprachen, die in die Pandanus-Sprachen integriert werden, womit Sprachkontakte und kulturelle Interaktionen sichtbar werden. Die Behandlung des spezifischen Wortes für Karuka ist ein Beispiel für die Variabilität: Während in der Kewa-Sprache das Wort zumeist als „aga“ verwendet wird, heißt es in der Pandanus-Variante „rumala agaa“. In der Kalam-Sprache bleibt das Wort dagegen unverändert, was auf unterschiedliche kulturelle Perspektiven und Umgangsweisen hinweist.
Sechs Hauptsprachen wurden als Träger von Pandanus-Registern identifiziert. Dazu gehören Imbongu, Kalam, Kewa, Kobon, Melpa und Mendi. Auch das Taiap wird erwähnt. Diese Sprachen besitzen jeweils eigene Versionen der Vermeidungssprache, die je nach sozialem Kontext und lokalen Gebräuchen variieren können. Besonders hervorgehoben ist die Kalam-Pandanus-Sprache, die ebenfalls zur Zeiten des Verzehrs oder der Zubereitung des Kasuars angewendet wird – einem kulturell wichtigen Vogel.
Anders als bei anderen Formationen dient diese Sprachvariante weniger der Geisterbeschwörung als vielmehr der Sicherstellung der Qualität der Nüsse. Auch wird sie ungeachtet der blinden Angst vor Geistern teilweise außerhalb des Waldes genutzt, was auf einen anderen gesellschaftlichen Umgang mit der Vermeidungssprache in dieser Region hindeutet. Archäologische und linguistische Forschungen geben Hinweise darauf, dass die Kalam-Pandanus-Sprache möglicherweise mehrere tausend Jahre zurückreicht und ihre Ursprünge in älteren Sprachformen sieht. Das Phänomen der Vermeidungssprachen ist im neuguineischen Kontext nicht auf die Pandanus-Ernte beschränkt. Auch bei den Huli etwa existiert eine Vermeidungssprache namens „tayenda tu ha illili“ („bush divide taboo“), die nicht nur bei der Karuka-Sammlung angewandt wird, sondern auch beim Jagen und Wandern in der Wildnis.
Ziele sind hier ebenfalls die Abwehr von feindlich gesinnten Naturgeistern oder die Vermeidung von Unglück. Solche sprachlichen Register sind tief in den religiösen und sozialen Strukturen dieser Kulturen verankert und verdeutlichen die Verbindung zwischen Sprache, Umwelt und Glauben. Ein ernstzunehmendes Problem ist der Rückgang der Verwendung der Pandanus-Sprachen. Mit der wachsenden Verbreitung von Tok Pisin als Verkehrssprache gehen traditionelle Sprachformen verloren. Zudem nimmt die Furcht vor den gefährlichen Wäldern ab, und jüngere Generationen sehen immer weniger Notwendigkeit, die aufwendige Vermeidungssprache zu erlernen oder anzuwenden.
Bereits in den 1990er-Jahren wurde dokumentiert, dass einige dieser Pandanus-Sprachen, beispielsweise die der Kewa und Imbongu, vom Aussterben bedroht sind. Der Verlust dieser Sprachen würde nicht nur sprachliche Vielfalt reduzieren, sondern auch ein bedeutendes Stück kulturelles Erbe und Wissen um die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt verschwinden lassen. Das Untersuchungspotenzial der Pandanus-Sprachen ist vielseitig. Sie liefern wertvolle Einblicke in die Art und Weise, wie Sprache als kulturelle Technologie genutzt wird, um soziale Normen durchzusetzen und Naturphänomene zu beeinflussen. Die Verbindung von tabuisiertem Vokabular, Mythen und rituellen Praktiken zeigt, dass Sprache in diesen Kulturen weit über die reine Informationsvermittlung hinaus sozialen und spirituellen Funktionen dient.
Für Sprachwissenschaftler bieten sie die Möglichkeit, seltene Bereiche der Sprachgestaltung zu erforschen, in denen das lexikalische System gezielt modifiziert und neu organisiert wird. Ethnologen können anhand der Pandanus-Sprachen das komplexe Zusammenspiel von Sprache, Umweltglauben und sozialem Zusammenhalt nachvollziehen. Darüber hinaus stellt sich die Frage, inwiefern solche ritualisierten sprachlichen Praktiken eine nachhaltige Beziehung der Menschen zur Natur fördern. Die Hoffnung auf eine gute Ernte durch die Einhaltung von sprachlichen Tabus kann als Ausdruck einer tiefen ökologischen Verbundenheit verstanden werden – eine Form des „Sprachschutzes“ der Natur. Gleichzeitig offenbaren die Pandanus-Sprachen den Einfluss kultureller Überlieferungen auf das Umweltverhalten, der heute durch gesellschaftlichen Wandel, Globalisierung und Fremdsprachen bedroht ist.