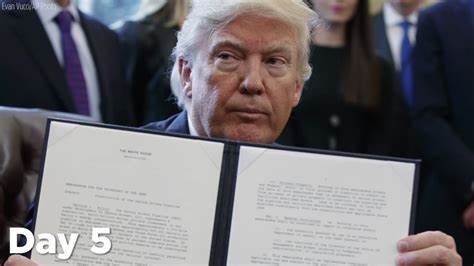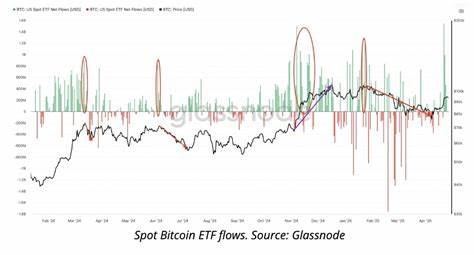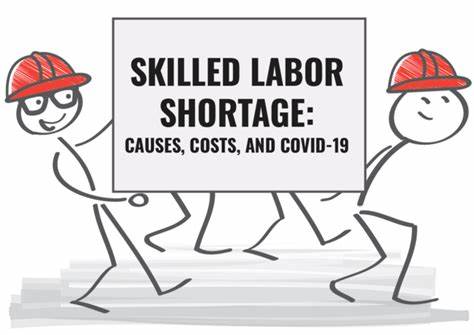Die ersten 100 Tage einer Präsidentschaft gelten traditionell als richtungsweisend für die Regierungszeit eines amerikanischen Präsidenten. Sie bieten einen Überblick über politische Prioritäten, Strategie und den Ton, der das Land in den kommenden Jahren prägen wird. Die zweite Amtszeit von Donald Trump begann jedoch mit einem beispiellosen Angriff auf Umweltrichtlinien und Klimaschutzmaßnahmen, der von Umweltorganisationen, Wissenschaftlern und politischen Experten als „all-out assault“ – ein umfassender Angriff – beschrieben wurde. Diese Periode führte zu erheblichen Veränderungen in der US-Umweltpolitik, die nicht nur nationale, sondern auch internationale Auswirkungen auf den Kampf gegen den Klimawandel haben. Die Ausgangslage war von großem Interesse für Umweltaktivisten und politische Beobachter.
Schon in Trumps erster Amtszeit war eine klare Abkehr von den Klimazielen der Obama-Administration erkennbar, ebenso wie eine Förderung fossiler Brennstoffe auf Kosten erneuerbarer Energien. Doch die Intensität und Geschwindigkeit der Veränderungen in den ersten 100 Tagen seiner zweiten Amtszeit überschritten sämtliche Erwartungen sogar noch. Ein zentraler Aspekt war die systematische Rücknahme oder Abschwächung von Umweltvorschriften. Die Environmental Protection Agency (EPA) wurde massiv ausgedünnt: Budgetkürzungen um bis zu 65 Prozent, Personalentlassungen und die Abschaffung zahlreicher Programme stellten einen radikalen Bruch mit bisherigen Schutzmaßnahmen dar. Kritisch betrachtet erschwerten diese Maßnahmen den Schutz von Luft, Wasser und ökologisch sensiblen Gebieten erheblich.
Die Umweltbehörde wurde so in ihrer Fähigkeit eingeschränkt, Verschmutzungen effizient zu regulieren und zu kontrollieren – was zahlreiche Umweltexperten vor dramatische Folgen für die öffentliche Gesundheit warnten. Die politische Rhetorik der Administration stand dabei in starkem Gegensatz zu den faktischen Maßnahmen. Offizielle Kommuniqués wie eine Pressemitteilung zum Earth Day betonten Fortschritte bei Energieinnovation und Umweltschutz, was von Beobachtern als „Doublespeak“ kritisiert wurde. Während die Verwaltung mit Schlagworten wie „saubere Energie“ und „Schutz der öffentlichen Ländereien“ warb, palten sich in der Realität massive Schritte, die Förderungen erneuerbarer Energien wurden abrupt gestoppt oder deutlich eingeschränkt, Kohleförderung und fossile Brennstoffe hingegen wurden massiv gefördert und durch den Abbau von Regulierungen unterstützt. Ein besonders kontroverses Thema war die Entscheidung, den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen weiter voranzutreiben.
Dies schickte ein klares Zeichen an die internationale Gemeinschaft, dass die Vereinigten Staaten unter der Trump-Administration keine führende Rolle im Klimaschutz einnehmen würden. Fachleute warnten, dass die Verzögerung oder Abschaffung von Klimazielen einen Rückschlag von mehreren Jahrzehnten bedeuten könnte und die US-Emissionen langfristig dramatisch steigen lassen würde. Auch die Unterstützung schwerer Industrien führte zu einem Rückschritt im Bereich des Naturschutzes. Zahlreiche Nationalmonumente und Naturschutzgebiete, die unter Schutz standen, wurden verkleinert oder deren Status in Frage gestellt. Zusätzlich wurden wichtige Umweltbehörden personell stark reduziert, was sich negativ auf das Monitoring, den Schutz bedrohter Tierarten und die Durchsetzung von Umweltgesetzen auswirkte.
Zudem stellte die Administration weite Landstriche für industriellen Bergbau und Öl- sowie Gasförderung offen – Maßnahmen, die sowohl Umweltschützer als auch lokale Gemeinschaften massiv kritisierten. Besonders gravierend war, dass Umweltgerechtigkeit und der Schutz benachteiligter Bevölkerungsgruppen in den Hintergrund rückten. Zahlreiche Programme zur Verbesserung der Lebensqualität in besonders belasteten Gemeinden wurden eingefroren oder abgeschafft. Die EPA setzte die Berücksichtigung von Rasse und sozioökonomischem Status in ihrer Umweltüberwachung aus, was Experten als Rückschritt bei der Bekämpfung von Umweltungerechtigkeiten bewerten. Viele dieser Gemeinschaften leiden schon seit Jahrzehnten unter überdurchschnittlichen Belastungen durch Luft- und Wasserverschmutzung – der fehlende Schutz verstärkt soziale Ungleichheiten und birgt Risiken für die öffentliche Gesundheit.
Wissenschaftler erlebten in diesen Monaten ebenfalls eine schwierige Zeit, da die Finanzierung wichtiger Forschungsbereiche drastisch gekürzt wurde und Klimaforschung vielfach ignoriert oder gar aktiv sabotiert wurde. Durch den Abzug aus internationalen Klimainitiativen und die Reduzierung von Wissenschaftlerstellen an Bundesbehörden entstand ein Klima der Unsicherheit, das langfristige Folgen für die US-amerikanische Wissenschaft und ihre Position in globalen Forschungsnetzwerken haben könnte. Landwirtschaftliche Förderprogramme, die nachhaltige Praxis und den Klimaschutz in der Landwirtschaft unterstützten, wurden massiv reduziert oder neu ausgerichtet, um „klimafeindliche“ und „linksgerichtete“ Inhalte zu vermeiden. Diese Veränderung gefährdete insbesondere kleinere Landwirte, die auf diese Unterstützung angewiesen sind, und stellte einen Rückschritt in der Bekämpfung des menschengemachten Klimawandels dar. Vor diesem Hintergrund ist es wenig überraschend, dass Umweltschutzorganisationen, Wissenschaftler und viele US-Bürger mit großer Sorge auf diese radikalen Maßnahmen reagierten.
Sie warnten vor langfristigen Gesundheits- und Umweltschäden und forderten den Widerstand gegen die hastig durchgesetzten Erlasse und Budgetkürzungen. Mehrere Klagen vor Gericht wurden eingereicht, um einige der umweltpolitischen Rückschritte aufzuhalten und die Rechtsstaatlichkeit zu bewahren. Die wirtschaftlichen Folgen dieser umweltpolitischen Kehrtwende sind ebenfalls nicht zu unterschätzen. Der Stopp zahlreicher nachhaltiger Energieprojekte, etwa im Bereich Solar- oder Windenergie, führt zu einem Verlust von Milliardeninvestitionen und zehntausenden Arbeitsplätzen. Gleichzeitig setzt die Administration weiter auf fossile Energieträger, die zwar kurzfristig Arbeitsplätze schaffen mögen, jedoch eine Abhängigkeit von klimaschädlichen Technologien und Importen fördern.
Zusätzlich wurde die Haltung der Trump-Administration in der Umweltpolitik auch international mit Kritik bedacht. Die USA, traditionell eine der Hauptverursacher von Treibhausgasen, verzichteten auf ihre Vorreiterrolle und zogen sich aus globalen Kooperationsprojekten zurück. Dies beeinträchtigte die globale Klimapolitik, da andere Länder nun weniger Anreize sehen, ehrgeizige Ziele zu verfolgen. Wissenschaftler und internationale Organisationen warnten vor einer Isolation der USA und einer gefährlichen Verlangsamung weltweiter Klimaschutzbemühungen. Trotz dieser Herausforderungen gibt es jedoch auch die Hoffnung, dass der gesellschaftliche Widerstand gegen die Umwelt- und Klimapolitik der Trump-Administration wächst.
Aktivistengruppen, NGO-Netzwerke und betroffene Gemeinschaften formierten sich neu, entwickelten Strategien für den juristischen und politischen Widerstand und belasten den Gesetzgebungsprozess merklich. Zahlreiche Gerichtsverfahren zwingen die Regierung dazu, sich an Umweltgesetze zu halten und einige der extremsten Regulierungslockerungen zu überdenken. Darüber hinaus führte die mediale Berichterstattung über die Umweltpolitik der Trump-Administration zu einer wachsenden öffentlichen Sensibilisierung für die Bedeutung von Umweltschutz und nachhaltiger Entwicklung. Die dramatischen Bilder von Umweltschäden, Luft- und Wasserverschmutzung sowie Extremwetterereignissen, die durch den Klimawandel begünstigt werden, lösten insbesondere bei jüngeren Generationen verstärktes Engagement aus. Rückblickend lässt sich sagen, dass die ersten 100 Tage von Trumps zweiter Amtszeit eine Phase radikaler Umwälzungen und Rückschritte für Umweltschutz und Klimapolitik darstellen.
Die Administration hat durch Gesetzesänderungen, Personalabbau und den Abbau von Schutzvorschriften die Weichen klar auf eine Priorisierung fossiler Energieträger und eine deutliche Beschneidung von Umweltaufgaben gestellt. Dies hat nicht nur kurzfristige Umwelt- und Gesundheitsrisiken erhöht, sondern auch die Grundlagen für langfristigen Klimaschutz erheblich untergraben. Zugleich hat diese umfassende Attacke auf Umwelt- und Klimaschutz auch eine breite gesellschaftliche Reaktion ausgelöst, die den politischen und rechtlichen Widerstand neu befeuert hat. Wie nachhaltig und erfolgreich dieser Widerstand sein wird, hängt künftig davon ab, wie Gerichte, Gesetzgeber und die Öffentlichkeit auf die Herausforderungen reagieren und die Balance zwischen wirtschaftlichen Interessen und ökologischem Erbe wieder stärker zugunsten nachhaltiger Lösungen verschieben. Die Debatte um die Umweltpolitik untertrifft nicht die Tragweite der globalen Klimakrise und zeigt, wie essenziell eine verlässliche, wissenschaftlich fundierte und langfristig orientierte Politik ist, um Umweltschäden einzudämmen und künftigen Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen.
Die ersten 100 Tage der zweiten Trump-Amtszeit dienen somit auch als warnendes Beispiel und Mahnung in Bezug auf den notwendigen Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen und den Schutz unseres Planeten.