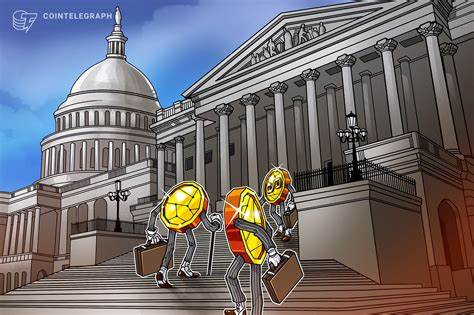Die Bekämpfung des Klimawandels erfordert vielfältige Strategien, die Treibhausgasemissionen senken und gleichzeitig natürliche Kohlenstoffsenken stärken. Die Wiederherstellung von Wäldern – inklusive Wiederaufforstung und Aufforstung – gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung. Bäume binden beim Wachstum Kohlenstoffdioxid (CO2) aus der Atmosphäre und können so erheblich zur Abschwächung der Erderwärmung beitragen. Doch die Klimawirkung von Baumpflanzungen ist komplex und wird nicht allein durch die Kohlenstoffbindung bestimmt. Neben biogeochemischen Effekten spielen biogeophysikalische Faktoren und insbesondere atmosphärische chemische Prozesse eine entscheidende Rolle, die bislang kaum berücksichtigt wurden.
Neue Studien zeigen, dass diese Wechselwirkungen das Klimaschutzpotenzial von Baumpflanzungen erhöhen und unterschätzte Effekte eine wichtigere Rolle spielen als bisher angenommen. Traditionelle Sichtweise auf Klimaeffekte der Baumpflanzung Bäume wirken als natürliche CO2-Senken und entziehen der Atmosphäre dadurch klimaschädliches Gas. Dieses Potenzial wurde vielfach als ein zentraler natürlicher Beitrag zum Klimaschutz anerkannt. Allerdings haben zugleich biogeophysikalische Effekte wie Veränderungen der Oberflächenalbedo, also die Rückstrahlfähigkeit der Erdbodenoberfläche, eine nicht zu unterschätzende Gegenwirkung. Speziell in borealen oder temperaten Regionen führt Aufforstung oft zu einer Abnahme der Albedo, da dunkle Baumkronen mehr Sonnenlicht aufnehmen als helle Bodenflächen, Schnee oder Grasland.
Das kann zu einer Erwärmung führen und so einen Teil des durch CO₂ gebundenen Kühlungseffekts kompensieren. In tropischen Regionen wirken dagegen erhöhte Verdunstung und Wolkenbildung meist kühlend. Insgesamt wurden diese verschiedenen Effekte hinsichtlich ihrer Klimawirkung bislang nur unzureichend simultan betrachtet. Atmosphärische Chemie: Ein bislang unterschätzter Faktor Die atmosphärische Chemie umfasst Wechselwirkungen von Spurengasen, Aerosolen sowie deren Einfluss auf Wolkenbildung und Strahlungshaushalt der Erde. Pflanzen emittieren organische flüchtige Verbindungen wie Isopren und Monoterpene, sogenannte biogene VOCs (BVOCs).
Diese Substanzen können mit anderen Stoffen in der Atmosphäre reagieren und sekundäre organische Aerosole (SOA) bilden. Aerosole wiederum beeinflussen sowohl die direkte Sonneneinstrahlung als auch die Wolkenbildung, unter anderem durch erhöhtes Vorhandensein von Kondensationskeimen für Wolkentröpfchen. Somit ist der aerosol-basierte Effekt ein wichtiger klimatischer Rückkopplungsmechanismus, der sich aus der Pflanzen-Atmosphäre-Wechselwirkung ableitet. Modellierungsergebnisse bestätigen den Einfluss der atmosphärischen Chemie auf die Klimawirkung von Baumpflanzungen In jüngsten klimamodellbasierten Studien wurde erstmals eine Baumrestaurierungssimulation mit interaktiver atmosphärischer Chemie gegenüber einer Simulation ohne diese Chemieeffekte verglichen. Dabei zeigte sich, dass die Einbeziehung von BVOCs und daraus resultierender SOA-Bildung eine deutliche Abkühlung bewirkt, die das biogeophysikalisch bedingte Oberflächenabsenkungspotenzial übersteigt oder zumindest teilweise kompensiert.
Insbesondere im Süden der Erde, wo tropische Bäume in großen Mengen gepflanzt werden, führt die Zunahme an organischen Aerosolen und die daraus resultierende Wolkenbildung zu einer signifikanten Abnahme der solaren Einstrahlung am Boden. So wird die erwartete Erwärmung durch dunklere Oberflächen stark vermindert oder sogar ins Gegenteil verkehrt. Regionale Unterschiede und hemisphärische Asymmetrien Die Modellrechnungen belegen eine deutliche Differenz zwischen Nord- und Südhalbkugel: Aufforstung im Norden bewirkt eine geringere Kühlung als im Süden. Dies hängt mit den unterschiedlichen Baumarten und deren BVOC-Emissionsprofilen zusammen. Tropische Bäume im Süden emittieren in größerem Umfang flüchtige organische Verbindungen, die zur SOA-Bildung beitragen.
Dadurch ist die aerosolinduzierte Abkühlung im Süden stärker ausgeprägt. Der Norden hingegen ist durch mehr temperate und boreale Wälder mit weniger BVOC-Emissionen geprägt, zudem überwiegt hier der Albedoeffekt der dunkleren Baumbedeckung, was zu einer geringeren Netto-Klimaschutzwirkung führt. Weitere klimatische Nebeneffekte von Baumpflanzungen Neben den bereits genannten chemisch-physikalischen Effekten beeinflussen Aufforstungen unter anderem auch die regionale Wasserbilanz. Erhöhte Verdunstungsraten durch Wälder tragen zu einer feuchteren Atmosphäre und verstärkter Wolkenbildung bei, was wiederum klimatische Rückkopplungen auslöst und Niederschlagsmuster verschiebt. Die Kombination aus mehr Bäumen, gesteigerter Verdunstung und Aerosolen führte in Simulationen zu einer Verringerung der Brandgefahr in tropischen Wäldern, da höhere Luftfeuchtigkeit die Brennbarkeit verringert.
Im Gegensatz dazu steigt in extratropischen Gebieten mit Baumzuwachs teilweise das Brandrisiko durch Änderungen im Wasserhaushalt und Temperaturanpassungen, allerdings wird diese Wirkung durch atmosphärische Chemieeffekte deutlich abgeschwächt. Bedeutung für die Klimapolitik und Klima-Anpassungsstrategien Die neuen Erkenntnisse unterstreichen, dass Baumpflanzungen als Maßnahmen zur Klimaanpassung und -minderung noch vielversprechender sind als bisher angenommen, vorausgesetzt, atmosphärische chemische Wechselwirkungen werden berücksichtigt. Dies hat direkte Folgen für politische Programme, da insbesondere großangelegte Aufforstungen in den Tropen und Subtropen größere Klimaeffekte entfalten können als einfache Kohlenstoffbindungsgleichungen vermuten lassen. Zudem zeigt sich, wie wichtig ein integrierter Ansatz ist, der atmosphärische Chemie, Biogeophysik sowie Kohlenstoffkreislauf kombiniert betrachtet. Zukünftige Forschungsrichtungen und Herausforderungen Die aktuelle Forschung basiert auf modellierten Szenarien mit statischen oder sofort eingeführten Baumflächen, was zwar Obergrenzen für Aufforstungspotenziale zeigt, aber die langsamen zeitlichen Entwicklungen nicht vollständig abbildet.
Zukünftige Arbeiten sollten schrittweise Pflanzungen mit dynamischen Emissionsmodellen einbeziehen, um realistischere Klimareaktionen zu erfassen. Darüber hinaus sind unterschiedliche Klimamodelle und höhere räumliche Auflösungen wünschenswert, um Unsicherheiten zu minimieren. Wichtig ist auch eine bessere Integration des Landnutzungswandels mit sozioökonomischen Faktoren, die die Umsetzung von Baumpflanzprojekten beeinflussen. Auch müssen ökologische und atmosphärische Aspekte der Luftqualität bei großflächiger Aufforstung weiter untersucht werden, da BVOCs in bestimmten Regionen lokale Ozon- und Partikelkonzentrationen erhöhen können. Neben dem Klimaschutz wird somit auch Lüftung und Gesundheit der Bevölkerung berührt.
Fazit: Atmosphärische Chemie verstärkt das Klimaschutzpotenzial von Baumpflanzungen Die Integration atmosphärischer Chemie in Klimamodelle erweitert das Verständnis der Klimawirkung von Baumpflanzungen erheblich. Die durch Pflanzen emittierten BVOCs fördern Aerosol- und Wolkenbildung, welche die Oberflächenabkühlung verstärken und die Albedo-bedingte Erwärmung abmildern. Dadurch steigt das Nettoklimaschutzpotenzial von Aufforstungen, insbesondere in den Tropen und auf der Südhalbkugel. Bisherige Studien unterschätzten diese Effekte oft, was wiederum zu konservativen Schätzungen des Klimanutzen von Baumpflanzungen führte. Die Erkenntnisse unterstützen eine verstärkte Einbindung ökologischer Klimaschutzmaßnahmen in nationale und internationale Klimastrategien und unterstreichen die Dringlichkeit, die atmosphärische Chemie in zukünftigen Modellen und politischen Überlegungen zu berücksichtigen.
Die Vielschichtigkeit der Baumpflanzwirkungen zeigt, dass Lösungen für den Klimawandel nur interdisziplinär und ganzheitlich entwickelt werden können.