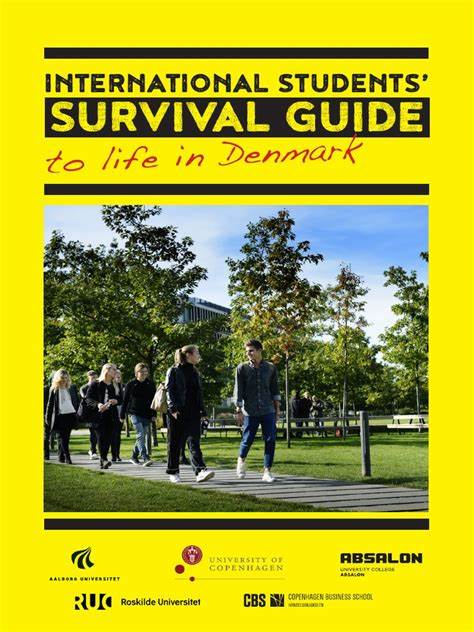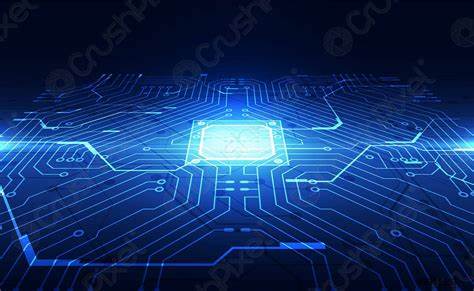In unserer heutigen Zeit erleben wir eine merkwürdige kulturelle Verschiebung, die man als „Who Cares Era“ bezeichnen könnte – auf Deutsch etwa die „Ära des Gleichgültigen“. Es ist eine Epoche, in der scheinbar niemand mehr wirklich Sorge trägt, Verantwortung übernimmt oder sich ernsthaft engagiert. Dieses Phänomen zeigt sich in unzähligen Lebensbereichen, von der Medienproduktion über politische Entscheidungen bis hin zum alltäglichen Umgang miteinander. Doch woher kommt diese Haltung, was sind ihre Auswirkungen und wie können wir ihr entgegenwirken? Während viele diesen Zustand der Oberflächlichkeit und Gleichgültigkeit bemerken, sind die Ursachen vielschichtig, tiefgreifend und mit der fortschreitenden Digitalisierung und dem Aufstieg von Künstlicher Intelligenz (KI) eng verbunden. Gleichzeitig steckt in der Gegenbewegung eine Chance, Menschlichkeit, Sorgfalt und Kreativität neu zu beleben.
Die digitale Revolution hat unser Leben fundamental verändert. Informationen und Inhalte sind heute im Überfluss vorhanden. Doch dieses Überangebot hat seine Schattenseiten. In der „Who Cares Era“ wird immer mehr Wert auf schnelle, oberflächliche Inhalte gelegt, die keinen echten Tiefgang besitzen. Unsere Aufmerksamkeitsspanne hat sich dramatisch verkürzt, und die Mehrheit konsumiert Inhalte eher nebenbei, im Multitasking-Modus, ohne sich jemals wirklich auf ein Werk einzulassen.
Der Einfluss von sozialen Medien spielt dabei eine Schlüsselrolle. Plattformen wie Instagram, TikTok oder Twitter fördern kurzlebige Trends, schnelle Unterhaltung und verzerren unseren Fokus auf das, was unmittelbar begeistert oder leicht verständlich ist. Tiefergehende Inhalte werden aus Geld- und Zeitmangel seltener produziert und vor allem seltener gesehen.Ein Beispiel dieses Phänomens lässt sich in der Medienwelt beobachten. Früher wurden aufwendige Reportagen, investigativer Journalismus und kulturell bedeutende Produktionen geschätzt und gefördert.
Heute hingegen unterliegen viele Inhalte einem Performance-Diktat, bei dem Reichweite und Klickzahlen höher gewichtet werden als journalistische Qualität. Der Fall der gefälschten „Special Supplements“, in denen Fakten und Expertenmeinungen von KI generiert wurden, ist symptomatisch. Es zeigt, wie wenig bis gar keine Sorgfalt an den Tag gelegt wird – angefangen von den Autoren über die Redakteure bis hin zu den Verantwortlichen für Produktion und Verkauf. Und wenn zwei ganze Tage verstreichen, bis überhaupt jemand den Fehler bemerkt, illustriert das die tiefe Gleichgültigkeit aller Beteiligten und des Publikums gleichermaßen.Künstliche Intelligenz steht im Zentrum vieler Debatten rund um Qualität und Kreativität.
KI-Systeme sind darauf ausgelegt, auf Basis großer Datenmengen zu extrapolieren und in kurzer Zeit Inhalte zu erstellen, die „gut genug“ erscheinen. Sie funktionieren als eine Art Mittelmaß-Maschine, die den sogenannten Durchschnitt repliziert und damit Einzigartigkeit und innovative Ansätze untergräbt. Für viele Nutzer ist dieses „gerade noch akzeptabel“-Niveau ausreichend, denn bei genauerem Hinsehen entlarvt die KI den Mangel an Tiefe und Originalität schnell. Doch Daumen mal Pi scheint für den Großteil der Menschen der neue Standard zu sein, was das einstige Ideal von Qualität immer weiter verwässert. Passivität und ein mangelndes Bewusstsein sorgen dafür, dass die Verbreitung von mittelmäßigen KI-Inhalten rasant zunimmt.
Das Problem ist jedoch nicht ausschließlich technischer Natur. Die Künstliche Intelligenz liefert nur das Werkzeug, doch die eigentliche Ursache liegt in unserer Kultur und Gesellschaft, die sich zunehmend von sorgfältiger Arbeit und bewusstem Engagement entfernt. Ein Gespräch, das sich einst um tiefgründige Themen wie theoretische Physik und Multiversen drehte, entwickelte sich beispielsweise zu einem seichten „Chat-Format“ um Internet-Trends und seichte Themen, die schnell konsumiert und schnell vergessen werden. Diese Entwicklung ist ein Spiegelbild des allgemeinen Trends hin zu Inhalten, die problemlos nebenbei konsumiert werden können. Anspruchsvolle Themen haben das Nachsehen gegenüber leichter Unterhaltung.
Hanif Abdurraqib, ein bekannter Künstler und Autor, prangerte dies an, indem er die hohe Qualität und den Aufwand bewunderte, der in aufwändige Produktionen wie seinen Podcast „Time Machine“ investiert wurde. Projekte dieser Art sind heute kaum noch finanzierbar oder werden gar nicht erst gestartet, da niemand mehr bereit ist, in Inhalte zu investieren, die nicht den sofortigen Massengeschmack treffen. Das ist auch ein Beleg dafür, dass Werte wie Tiefe, Authentizität und menschliche Kreativität immer weniger geschätzt werden. Absurderweise wird auch seine enge Bindung an vergängliche Social-Media-Formate wie Instagram Stories als Symptom dieser Epoche betrachtet, die Inhalte und Gedanken nur temporär gelten lässt.Die politische Landschaft verstärkt diese Tendenzen noch.
Die vermehrte Gleichgültigkeit gegenüber sozialen Belangen, öffentlicher Infrastruktur oder dem staatlichen Handeln ist inzwischen geradezu programmatisch. Institutionen werden heruntergewirtschaftet, Budgets gekürzt und komplexe gesellschaftliche Probleme mit simplifizierten Aussagen oder Ignoranz behandelt. Die Zuspitzung dieser Haltung spiegelt sich darin wider, dass eine Vielzahl von Aufgaben und Verantwortlichkeiten sogar an KI-Systeme delegiert werden soll – mit dem Argument, dass Menschen nicht mehr benötigt werden und eine maschinelle „Genügsamkeit“ ausreicht. Damit verliert die öffentliche Hand nicht nur an Kompetenz, sondern auch an Empathie und Verantwortungsbewusstsein.Diese Desillusionierung und das Gefühl von Gleichgültigkeit hat gravierende Auswirkungen auf individuelle Lebensbereiche.
Ein persönliches Beispiel verdeutlicht das eindrucksvoll: Bei der Bewertung von Bewerbungsunterlagen fühlt man sich mit einer Flut ähnlicher Antworten konfrontiert, die allen Anschein nach mithilfe KI-generierter Textbausteine entstanden sind. Es fehlt die individuelle Note, das authentische Erleben, die menschliche Stimme. Viele Bewerber nutzen diese technischen Hilfsmittel, um Zeit zu sparen oder einen vermeintlich besseren Eindruck zu hinterlassen. Doch so entsteht eine erschreckende Uniformität, die gerade dort, wo persönliche Erfahrungen gefordert sind, die Einzigartigkeit der jeweiligen Person auslöscht.Doch das Gegenstück zu diesem Grau ist die bemerkenswerte Kraft des Gekümmertseins und des echten Interesses.
Sobald ein mehrheitlich menschlich verfasstes Dokument vorliegt, strahlt es wieder Leben und Persönlichkeit aus. Es erzählt Geschichten, weckt Emotionen und überrascht durch Kreativität und Tiefe. Dieses „Caring“, dieses bewusste Engagement, ist im Zeitalter der Gleichgültigkeit eine Form der Rebellion, eine radikale Handlung gegen die Austauschbarkeit und das Mittelmaß. Sich wirklich zu kümmern ist heute ein Mutzeichen, ein Ausdruck von Menschlichkeit und eine Einladung, die Welt bewusster und ehrlicher wahrzunehmen.Diese Erkenntnis führt uns zu einer wichtigen Schlussfolgerung: In einer Ära, in der Maschinen vielen Lebensbereichen eine gewisse Tristesse aufzwingen, sind wir dazu aufgerufen, das genaue Gegenteil zu tun.
Kreativität, Unvollkommenheit und Authentizität sind keine Makel, sondern Stärken. Statt perfekte, geglättete Produkte zu erzeugen, sollten wir Rohheit zulassen, eigene Fehler zulassen und das Unfertige als Wert begreifen. Nur so können wir der Einförmigkeit und dem „Einheitsbrei“ der heutigen Trenderstellung entgegenwirken.Dabei geht es nicht nur darum, individuelle Produkte zu schaffen, sondern auch darum, unsere Aufmerksamkeit als stärkste Ressource wieder bewusster einzusetzen. Ein gelebter Widerstand gegen den Multitasking-Holocaust, bei dem wir uns gleichzeitig durch eine Flut von Informationen scrollen, Videos halbanschauen und nebenher Nachrichten schreiben.
Stattdessen lohnt es sich, Inhalte tatsächlich mit voller Konzentration zu erleben, sei es ein Buch, eine lange Podcastfolge oder gar ein gedrucktes Magazin. Medien, die sich ihrer Qualität bewusst sind, können so wieder einen festen Platz in unserem Leben und in der Gesellschaft zurückerobern.Ebenso liegt eine politische Dimension in der Rückkehr zu echtem Engagement. Um die wachsende Kluft zwischen Staatsapparat und Bevölkerung zu schließen, sind verantwortungsbewusste, empathische Menschen nötig, die sich wirklich kümmern – statt alles teilen zu lassen oder algorithmisch zu delegieren. Dies gilt nicht nur im öffentlichen Dienst, sondern auch im sozialen Miteinander, in der Förderung von Kunst und Kultur sowie in der Bildung.
Es braucht Menschen, die Widerstand leisten gegen die „Who Cares“-Mentalität, die genügsame Mittelmaßproduktion und die Abkopplung von wirklichen Emotionen.Die Ära des Gleichgültigen ist also nicht zwangsläufig ein unvermeidliches Schicksal. Vielmehr liegt in ihr auch eine Aufforderung, bewusst zu handeln und wieder mehr Sorge zu tragen. Ob als Produzenten von Inhalten, im Umgang miteinander oder als gesellschaftliche Akteure – die Entscheidung, sich zu kümmern, ist eine machtvolle Antwort auf die Tristesse der Alltäglichkeit. Wer sich für echte Qualität entscheidet, wer sich traut, unperfekt zu sein und wer voller Hingabe an einem Werk oder einem Mensch zugegen ist, setzt ein Zeichen gegen den Verfall der kulturellen und sozialen Werte.
Daher ist der Appell klar: Lasst uns wieder sorgsam sein. Im Schreiben, im Zuhören, im Fühlen und im Handeln. Lass uns Inhalte kreieren, die berühren, herausfordern und authentisch sind. Unterstütze Menschen und Projekte, die echtes Engagement zeigen und sich der Gleichgültigkeit widersetzen. Nutze Medien bewusst, höre nicht nur nebenbei, sondern vollständig zu.