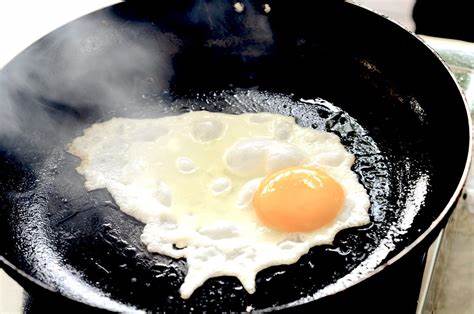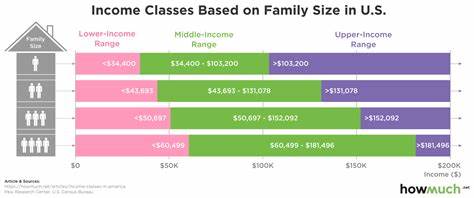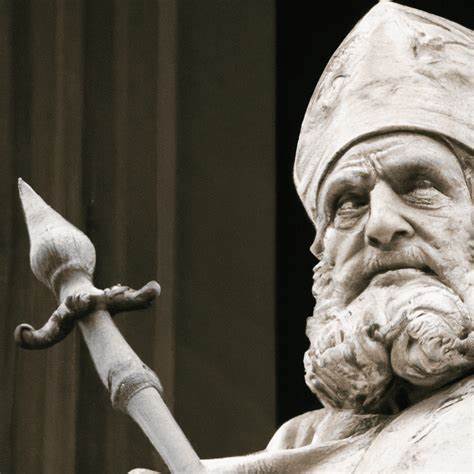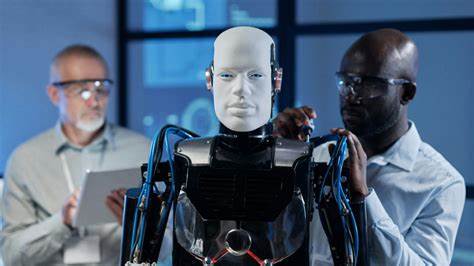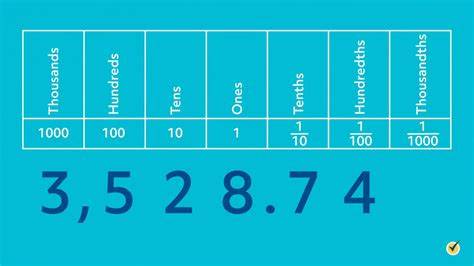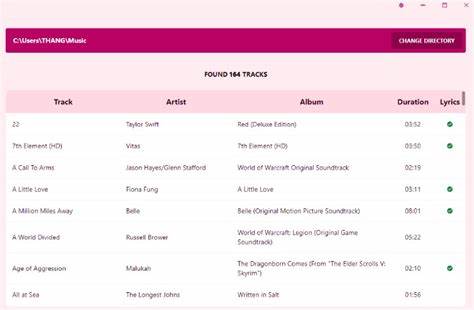Die weltweiten Finanzmärkte befinden sich weiterhin in einem Spannungsfeld, das maßgeblich von den Zollpolitiken der Trump-Administration beeinflusst wird. Obwohl in jüngster Zeit eine leichte Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China zu beobachten war, bleibt die Unsicherheit in Bezug auf die zukünftige Zollhöhe und -strategie bestehen. Diese Unsicherheit hat enorme Auswirkungen auf die Finanzplanung von Unternehmen und macht klassische Gewinnschätzungen und Prognosen nahezu bedeutungslos. Insbesondere große Konzerne fühlen sich in einem wirtschaftlichen Niemandsland gefangen, in dem stabile Voraussagen zu Umsätzen und Gewinnen nicht getroffen werden können. Die volatile Situation zwingt viele Unternehmen, ihre finanzielle Kommunikation gegenüber Investoren stark einzuschränken oder ganz einzustellen, da jede neue politische Ankündigung zu plötzlichen Anpassungen in den Kostenstrukturen führen kann.
Eine besonders brisante Entwicklung zeigt sich in der Haltung von CEOs großer Unternehmen, die sich angesichts der dynamischen und schwer vorhersehbaren Zollmaßnahmen zunehmend zurückziehen, wenn es um die Veröffentlichung von Gewinnprognosen geht. Das klassische Instrument der Guidance, mit dem Unternehmen bis vor wenigen Jahren noch relativ verlässlich ihre Ertragserwartungen mitteilten, hat in diesem Umfeld massiv an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Fachleute fordern Investoren daher eindringlich dazu auf, sich nicht mehr primär auf diese Zahlen zu verlassen, sondern eigene, kritischere Analysen anzustellen. Ein prominentes Beispiel für diese Entwicklung ist die Aussage von Bill George, ehemaliger Medtronic-CEO und Mitglied in den Aufsichtsräten großer Konzerne, der offen dazu aufrief, den Gang zu detaillierten Gewinnprognosen zu überdenken oder ganz auf sie zu verzichten. Er argumentiert, dass es wenig Sinn macht, verlässliche Zahlen zu kommunizieren, wenn zugleich die grundlegenden Rahmenbedingungen durch externe politische Faktoren ständig verändert werden.
George selbst hat in seiner langjährigen Erfahrung trotz enormer Belastungen des Marktes und einzelner Unternehmen nur einmal eine Gewinnschätzung verfehlt – das spricht für seine Warnung, die in der heutigen Situation besonders viel Gewicht hat. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China ist hierbei das Sinnbild einer komplexen globalen Makroökonomie, in der Handelsschranken und Zölle teils plötzlich und unerwartet aufgehoben oder erhöht werden. Für Unternehmen bedeutet dies, dass ihre Lieferketten ständig neu justiert werden müssen, um auf veränderte Kostenstrukturen zu reagieren. Eine drastische Erhöhung der Zollbelastung von teilweise bis zu 30 Prozent zwingt Firmen dazu, ihre Produktion kostspielig umzustrukturieren oder diese ganz in andere Länder zu verlagern, wenn überhaupt möglich. Die Folge sind erhebliche Störungen in der Kalkulation von Materialkosten und Margen, die sich unmittelbar in den Gewinn- und Verlustrechnungen niederschlagen.
Hinzu kommt, dass Konsumentenpreise in vielen Fällen angepasst werden müssen, was wiederum die Nachfrage nach Produktangeboten beeinflusst. Unternehmen sehen sich dadurch einemseits mit höheren Produktionskosten konfrontiert und andererseits mit der ungewissen Reaktion des Marktes auf mögliche Preiserhöhungen. Diese Kombination erschwert eine zuverlässige Prognose der Umsätze und Gewinne zusätzlich. Die Komplexität wird noch dadurch erhöht, dass manche Firmen versuchen, Kostensteigerungen durch Effizienzmaßnahmen oder Innovationen abzufangen, was jedoch meist erst mittelfristig wirken kann. Technologieunternehmen, insbesondere die sogenannten „Magnificent Seven“ – bestehend aus Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet (Google), Meta, Tesla und Nvidia – haben sich in diesem angespannten Umfeld besonders resilient gezeigt.
Dennoch sind auch hier Unsicherheiten bezüglich zukünftiger Gewinnspannen und Marktentwicklungen vorhanden. Die starke Kapitalisierung und Innovationskraft dieser Tech-Giganten gibt ihnen zwar ein gewisses Polster, jedoch bleiben ihre Prognosen, insbesondere im Hinblick auf internationale Handelsaktivitäten und Lieferketten, weiterhin mit Vorbehalten zu betrachten. Für Investoren bedeuten diese Umstände eine immense Herausforderung. Die klassische Methodik, auf Unternehmensprognosen und Analystenschätzungen zu bauen, ist aktuell zunehmend unbrauchbar. Die Marktreaktionen auf plötzliche politische Statements oder neue Zollerhöhungen sind oft heftig und führen zu erheblichen Kursschwankungen.
Dies erschwert nicht nur die kurzfristige Anlageentscheidung, sondern auch die langfristige Planung und Portfoliostrukturierung. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Bedeutung einer gründlichen Fundamentalanalyse und einer breiten Diversifizierung an Gewicht. Anleger sollten verstärkt auf fundamentale Unternehmensdaten sowie makroökonomische Indikatoren achten und sich nicht auf unsichere Gewinnberichte verlassen. Der Fokus sollte zudem darauf liegen, mit Unternehmen in Kontakt zu bleiben, die transparent kommunizieren und Strategieanpassungen offenlegen, anstatt sich allein auf starre Prognosezahlen zu verlassen. Das Verhalten vieler Unternehmen, ihre Guidance freiwillig auszusetzen oder nur sehr allgemein zu formulieren, ist daher als strategischer Schritt zu verstehen, um nicht durch Fehleinschätzungen in ein negatives Licht zu geraten oder falsche Erwartungen zu wecken.
Dies betrifft sowohl große globale Konzerne als auch mittelständische Unternehmen, die in starker Abhängigkeit von der Import- und Exportpolitik der USA stehen. Langfristig ist zu erwarten, dass nach einer Konsolidierung der Handelsspannungen auch wieder mehr Verlässlichkeit in den Prognosen Einzug hält. Doch bis es zu einem umfassenden Handelsabkommen und somit zu klaren Rahmenbedingungen kommt, müssen Anleger und Unternehmen weiterhin mit einer hohen Volatilität und einem erheblichen Maß an Unsicherheit rechnen. Die jüngste Entwicklung bei der Nasdaq, wo mit dem IPO von eToro ein symbolträchtiger Schritt hin zu neuen Börsengängen nach der sogenannten „Liberation Day“-Phase zu beobachten war, zeigt, dass trotz der Unsicherheiten weiterhin Kapitalflüsse in den Markt fließen. Doch auch hier wird von potenziellen Investoren häufig vor einer vorschnellen Erwartungshaltung gewarnt, da die kommenden Monate nicht nur in Bezug auf politische Entscheidungen, sondern auch aufgrund ausstehender wirtschaftlicher Daten als besonders ungewiss gelten.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Unsicherheit rund um Trumps Zollpolitik und die daraus resultierenden Handelskonflikte den Markt in eine nie dagewesene Lage versetzt haben. Die klassische Annahme, dass Gewinne und Prognosen klare Entscheidungsgrundlagen liefern, ist vorübergehend hinfällig. Unternehmen agieren in einem undurchsichtigen Umfeld, in dem kurzfristige Anpassungen an politische Veränderungen Alltag sind. Aus diesem Grund sollten Investoren bei der Bewertung von Unternehmenszahlen äußerste Vorsicht walten lassen und sich breiter aufstellen, um besser auf potenzielle Volatilitäten reagieren zu können. Erst wenn eindeutige und verlässliche politische Grenzen gezogen werden, kann von einer Rückkehr zu einer stabileren Prognosekultur gesprochen werden.
Bis dahin ist jedoch eher ein „Schießen ins Blaue“ bei Gewinnschätzungen angesagt – für Unternehmen genauso wie für Investoren.