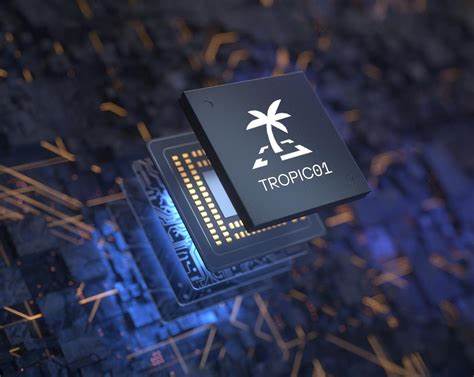AMD hat mit der Vorstellung der Van Gogh APU für das Steam Deck einen wichtigen Schritt in der Welt mobiler Gaming-Technologie vollzogen. Das Van Gogh bezeichnete System-on-Chip (SoC) ist ein einzigartiger Zusammenschluss von vier Zen 2-Kernen und einer modernen RDNA 2-Grafikeinheit. Es ist speziell dafür optimiert worden, um den besonderen Anforderungen eines tragbaren PC-Spielekonsols wie dem Steam Deck gerecht zu werden. In diesem Kontext wurde beachtliches Augenmerk darauf gelegt, das Verhältnis zwischen Leistungsfähigkeit und Energieeffizienz optimal zu balancieren, um auf engem Raum ohne aktive Lüftung oder massiven Kühlkörper ein flüssiges Spielvergnügen zu ermöglichen. Dabei stellt Van Gogh keine klassische Laptop- oder Desktop-CPU dar, sondern ist vielmehr eine speziell entwickelte Lösung mit einem sehr eng gesteckten Leistungsbudget und damit verbundenen Kompromissen, besonders auf Seiten der CPU.
Die Architektur der Van Gogh APU basiert auf einer hochgradig bewährten Zen 2-Kernserie, die AMD schon mit der Ryzen-3000-Generation bekannt gemacht hatte. Zum Zeitpunkt ihres Launchs markierte Zen 2 einen Durchbruch im Single-Thread- und Multithread-Computing für AMD, doch bei Van Gogh wurde das ursprünglich selbstbewusste Leistungsversprechen zugunsten eines möglichst geringen Stromverbrauchs bewusst zurückgeschraubt. So sind vier Zen-2-Kerne in einem einzigen Core-Complex (CCX) verbaut – ein Design, das bereits Leistung für acht Threads bietet, jedoch nicht den Mehrkern-Boost von zwei CCXs, wie man ihn von Desktop-Prozessoren kennt. Betriebstakte von 2,8 GHz Basis und 3,5 GHz Boost sind somit vergleichsweise konservativ, vor allem für eine Architektur, die eigentlich weitaus höhere Frequenzen stemmen könnte. Solche Taktgrenzen sind unter anderem der thermischen Enge und dem seltenen Einsatzfall geschuldet.
Die CPU-Seite leidet zudem unter einer recht kleinen Cache-Struktur. Während Desktop-Zen-2-Prozessoren mit 16 MB L3-Cache pro CCX aufwarten, bietet Van Gogh nur 4 MB, was sich nachhaltiger auf die Leistungsfähigkeit auswirkt. Cache bedeutet für die CPU gewissermaßen einen schnellen Zwischenspeicher, der sie vor der Trägheit des Arbeitsspeichers schützt. Hier kommt dann ein weiterer entscheidender Punkt ins Spiel: das eingesetzte LPDDR5-Arbeitsspeicher-Subsystem, das zwar mit theoretischen 88 GB/s Bandbreite glänzt, in der Praxis aber durch sehr hohe Latenzen eingebremst wird. Das Vorgehen erinnert eher an Konsolen-APUs als an ein traditionelles Notebook-System.
Die Speicherlatenz hat direkten Einfluss auf die Performance, da jeder Speicherzugriff spürbare Verzögerungen bedeutet. Insbesondere wenn die CPU mit ihren begrenzten Caches oft auf den Arbeitsspeicher zugreifen muss, leidet die schnelle Rechenleistung darunter. Die Speicherarchitektur mit LPDDR5 ist aber kein Zufall: Für die GPU-Seite von Van Gogh spielt die breite Speicheranbindung eine ganz andere Rolle. Die integrierte RDNA 2-basierte GPU verfügt über 512 FP32-Recheneinheiten, die in vier Work Group Prozessoren (WGPs) zusammengefasst sind. Sie läuft mit maximal 1,6 GHz, einer eher bescheidenen Taktfrequenz im Vergleich zu Desktop-GPUs, deren Taktraten weit über 2 GHz liegen können.
Dennoch ist sie gerade für die Leistungsklasse des Steam Decks beeindruckend. AMD verzichtet hier auf Features wie den Infinity Cache der größeren RDNA 2-Chips, setzt stattdessen aber auf die enorm hohe Speicherbandbreite, die der GPU ein flüssiges Rendering von PC-Spielen ermöglicht. Die Architektur wurde gezielt auf hohe Effizienz hin optimiert, um Grafikpower bei gleichzeitig kleinem thermischen Fußabdruck bereitzustellen. Das Zusammenspiel von CPU und GPU auf einer APU-Chipfläche bringt weitere besondere Anforderungen mit sich. Die flexible Zuteilung einer maximalen Leistungsaufnahme von ca.
16 Watt kann zwischen den CPU- und GPU-Kernen je nach Anwendung umgeschichtet werden. Zieht ein Spiel etwa besonders stark die GPU in Anspruch, erhält sie einen Großteil der Leistungsmedien, während die CPU-Taktrate deutlich heruntergeregelt wird – analog kann es auch umgekehrt passieren. Diese strikte Aufteilung ist für Tage voller Gaming-Sessions optimiert und erlaubt es, die Batterie des Steam Deck möglichst lange mit Strom zu versorgen, allerdings mit dem Nebeneffekt, dass bei Anwendungen mit stark gemischter Last nicht immer die volle Performance beider Systemteile gleichzeitig ausgeschöpft werden kann. Die Chip-Herde Van Gogh signalisiert durch die internen Namensbezeichnungen „AMD Custom APU 0405“ zudem, dass es sich um einen maßgeschneiderten Chip für Valve handelt. Valve verfolgt mit dem Steam Deck das Ziel, PC-Spieleerlebnis in ein tragbares Format zu packen, das Nintendo Switch ähnliche Bedienung und Ergonomie bietet.
Dennoch sind die technischen Anforderungen an Rechenleistung weit höher, da das Steam Deck nicht auf niedrige Komplexität oder Nintendo-exklusive Spiele ausgelegt ist, sondern darauf, vom PC stammende Titel mit hoher Kompatibilität abzuspielen. Die Herausforderung bestand darin, für diese ambitionierte Zielsetzung eine CPU-GPU-Kombination zu schaffen, die unter den restriktiven Energie- und Temperaturbedingungen eines Handhelds möglichst wenig Kompromisse eingeht, ohne dabei die Batterie übermäßig zu belasten. Interessant ist zudem das Verhalten der Taktanpassungen. Im Gegensatz zu Windows-Laptops oder Desktop-CPUs, die ihre Frequenzen innerhalb von Millisekunden fast auf das Maximum hochziehen, pausiert die Van Gogh-CPU beim Steam Deck bewusst für mehrere hundert Millisekunden bei niedrigen Taktraten, bevor sie schrittweise bis zum Boost-Level anhebt. Diese Regulierung ist wahrscheinlich eine bewusste Entscheidung von Valve, um das thermische Management zu erleichtern und die Batterieüberwachung zu verbessern.
Das Trade-off zwischen schneller Reaktionsfähigkeit und Effizienz schlägt hier eindeutig in Richtung letzteres durch, was bei Gameplays mit längeren Belastungsphasen weniger störend ist, bei kurzfristigen responsiven Anwendungen aber negative Auswirkungen haben kann. Des Weiteren ist die Kühlung des Steam Deck, das trotz seiner kompakten Bauweise eine heatpipe-basierte Wärmeabfuhr einsetzt, auf eine geräuscharme und platzsparende Lösung optimiert. Die Leistungsaufnahme von Van Gogh ist absichtlich auf ein Maximum von etwa 16 Watt begrenzt, was das Lüftergeräusch in Grenzen hält und für die meisten Titel eine passable Leistung ermöglicht. Aufwendige aktive Kühllösungen wie bei leistungsstarken Gaming-Laptops kommen hier nicht infrage. Das Wärme-Design spiegelt die Gewichtung von AMD und Valve wider: Maximale Nutzerzufriedenheit durch eine Kombination aus Ruhe, Akkulaufzeit und Gaming-Leistung.
Einem detaillierten Leistungsprofil folgend bietet Van Gogh ein gutes Beispiel für den aktuellen Trend hin zu speziell zugeschnittenen APUs in Nischenbereichen, die nicht den Allrounder-Ansatz traditioneller CPUs und GPUs verfolgen. Im Vergleich zu anderen Zen-2-basierten Mobil-Prozessoren wie Lucienne oder Mendocino zeichnet sich Van Gogh durch die ausgeprägte GPU-Fokussierung und die spezifisch angepasste Leistungsmanagement-Strategie sowie den Einsatz modernster Fertigungstechnologien bei TSMC mit 7 Nanometern aus. Diese Spezialisierung zeigt sich auch darin, dass Van Gogh ein relatives Novum innerhalb von AMDs Portfolio darstellt: Es kombiniert einen älteren, aber bewährten CPU-Kern mit einem stark überarbeiteten GPU-Block auf Basis von RDNA 2 und einem hochmodernen Speicherinterface mit LPDDR5. Diese Zutaten gleichen es mehr aus als nur eine einfache Mobil-CPU zu sein – es ist ein kleiner Gaming-Spezialist. Für die breite Öffentlichkeit bleibt Van Gogh aber ein weitgehend unsichtbarer Akteur.
Er hat keinen klassischen Produktnamen und ist allein in der Steam Deck Plattform verbaut, die sich mit über einer Million verkaufter Einheiten trotzdem als kleiner Erfolg in der Gaming-Welt positionieren konnte. Dennoch stellt die Technologie dieses SoC eine bedeutende Weiterentwicklung dar, die zeigt, wie AMD seine Kompetenzen im CPU- und GPU-Design kombiniert, um den Anforderungen moderner, eleganter HPC-Anwendungen innerhalb einer kleinen, mobilen Spielekonsole zu begegnen. Im Gesamtergebnis ist Van Gogh ein gelungenes Beispiel dafür, wie integrative APU-Designs in einer Zeit, in der Leistung unter Energie- und Wärmebegrenzungen immer wichtiger wird, eine Daseinsberechtigung und zugleich Innovationskraft besitzen. Das Steam Deck profitiert davon nicht nur durch eine flüssige Spielerfahrung über Stunden hinweg, sondern zeigt auch, wie mit strategischen Kompromissen und modernster Technologie eine Nische erfolgreich bedient werden kann. Die Kombination aus Zen 2 CPU-Kernen, einer RDNA 2-GPU, LPDDR5-Speicheranbindung und einem energieeffizienten Leistungsmanagement macht Van Gogh zu einem spannenden Modellfall für die Zukunft moderner Gaming-Hardware jenseits der traditionellen PC-Landschaft.
Letztlich demonstriert Van Gogh auch AMDs Fähigkeit, in wettbewerbsintensiven Märkten wie der mobilen Spieleplattform durch maßgeschneiderte Lösungen eine hervorragende Position innezuhaben und gegen andere Player wie Nvidia oder Intel mit ihren eigenständigen technologische Schwerpunkten effizient anzutreten. Die Zukunft dürfte weitere maßgeschneiderte APUs ähnlich wie Van Gogh sehen, die in spezialisierten Geräten mit klaren Performance- und Effizienzzielen neue Maßstäbe setzen.