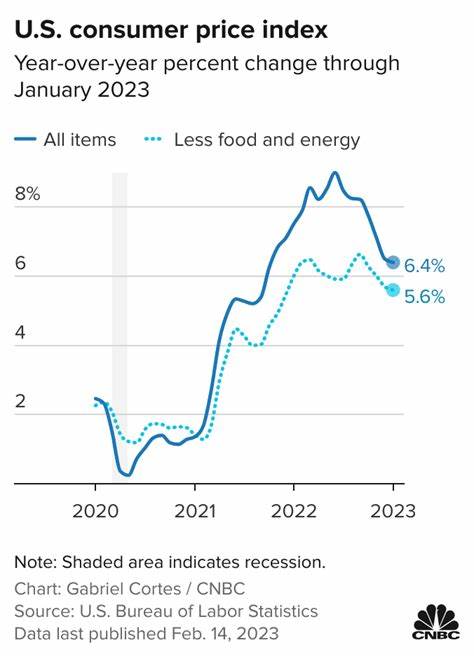Banknoten sind aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Obwohl die Nutzung von bargeldlosen Zahlungsmethoden zunimmt, begegnen uns Geldscheine weiterhin in vielen Situationen – von Supermärkten über Parkautomaten bis hin zu Spielautomaten. Doch wie genau wird eigentlich sichergestellt, dass die Scheine echt sind? Welche Technologien stecken in den Banknotenprüfern, die diese Überprüfung übernehmen? Und wäre es tatsächlich möglich, diese Geräte zu täuschen und eigene Geldscheine zu drucken? Die Antwort führt uns tief in die Welt der Banknotentechnik und das Reverse Engineering, eine Methode zur Entschlüsselung von technischen Systemen, die nur wenig Öffentlichkeit erfahren haben. Zunächst einmal muss man verstehen, dass Banknoten ausgestattet sind mit zahlreichen Sicherheitsmerkmalen, die speziell dazu entwickelt wurden, Fälschungen zu verhindern. Diese Merkmale sind oft so gestaltet, dass sie zum einen von jedermann leicht überprüfbar sind und zum anderen extrem schwierig zu kopieren.
Ein einzelner Sicherheitsaspekt reicht meist nicht aus, deshalb verfügen moderne Banknoten über mehr als zehn unterschiedliche Features. Dazu zählen Mikrodrucke, UV- und IR-Farben, holografische Elemente, farbwechselnde Beschichtungen, transparente Bereiche und Wasserzeichen, spezielle Papiersorten, magnetische Streifen oder Sicherheitsfäden und taktile Merkmale. Das Zusammenspiel dieser vielseitigen Schutzmechanismen nennt man Defence-in-depth – eine Art mehrschichtiger Schutz, der den Aufwand für Fälscher immens erhöht und wirtschaftlich unattraktiv macht. Was viele nicht wissen: Die Umsetzung dieser Schutzmechanismen ist eine physikalische Herausforderung, bei der Toleranzen unvermeidbar sind. Banknoten können leicht variieren – sei es in Farben, Größe oder exakt platzierten Details.
Daher müssen Geräte, die falsche von echten Scheinen unterscheiden, diese Schwankungen berücksichtigen und dennoch zuverlässig arbeiten. Banknotengeräte scheinen auf den ersten Blick simpel: LED-Reihen, Fotodetektoren und gelegentlich Magnetfeldsensoren bestimmen, wie das System die Echtheit misst. Doch ihre Funktionsweise ist durchdachter, als es der Laie vermuten würde. Diese Geräte nutzen diverse Sensoren, die verschiedene Eigenschaften von Scheinen erfassen und in Echtzeit auswerten. Etwa die Reflexion oder Durchsicht von Licht im sichtbaren, ultravioletten oder infraroten Bereich.
Ein interessantes Beispiel ist die Verwendung spezieller Magnetköpfe – ähnlicher Technologie wie bei alten Kassettenspielern – zur Erkennung magnetischer Eigenschaften in der Druckfarbe oder im Sicherheitsfaden. Die Bewegung der Banknoten durch das Gerät wird dabei mit optischen Encodern kontrolliert, die genaue Impulse erzeugen, sodass alle Sensoren synchron arbeiten können. Diese mechanischen Elemente, kombiniert mit einfachen Sensoreinheiten, ermöglichen eine schnelle Scandauer von nur etwa einer Sekunde. Trotz der vergleichsweise einfachen Elektronik profitieren diese Geräte von cleverer Signalverarbeitung und Firmware, die die Rohdaten von Sensoren in Echtzeit analysiert und miteinander vergleicht. Die Suche nach offenen Informationen über Banknotengeräte ist überraschend schwierig.
Bis auf ein paar technische Zerlegungen und Herstellerangaben existiert wenig öffentlich zugängliches Wissen darüber, wie die Validierungsalgorithmen genau funktionieren. Daher lohnt es sich, selbst Architekturen zu analysieren und Firmware zu untersuchen – ein klassischer Reverse-Engineering-Ansatz. Ein praktischer Zugang bestand darin, diverse Banknotengeräte direkt zu beschaffen – etwa gebrauchte Desktop-Validierer und professionelle Module für Automaten. Beim Zerlegen zeigte sich, dass die Geräte innerlich ziemlich einheitlich aufgebaut sind, mit wenigen Unterschieden in der Art der Hauptprozessoren wie Mikrocontroller, FPGAs oder CPLDs. Auch elektrische Bauteile wie LEDs, Fotodioden und passive Bauelemente wiederholten sich ähnlich.
Besonders spannend war der Fund eines alten Bandkopfes, ein Sensor, der magnetische Signale aus der Druckfarbe oder dem Sicherheitsfaden herausfiltern kann. Das ist eine clevere Wiederverwendung bewährter Technologie für die moderne Banknotenprüfung. Die Anordnung der Sensoren und die Kommunikationslogik mit dem Mikrocontroller offenbarten, wie die Geräte aus simplen Signalen komplexe Echtheitsprofile erstellen. Eine große Überraschung brachte das Firmware-Studium. Viele Banknote-Validatoren sind nämlich technisch gar nicht so komplex, wie man meinen könnte.
Die Firmware arbeitet mit Kalibrierungs- und Normalisierungstabellen, um Unterschiede bei den LEDs und Sensoren auszugleichen. Dies geschieht bei jedem Einschalten und vor jeder Banknoteneinführung, was Lichtschwankungen oder Alterung der Komponenten kompensiert. Die 12-Bit-ADC-Messwerte (Analog-Digital-Wandler) werden über Lookup-Tabellen in 8-Bit-Werte umgewandelt und dann per Gleitfensterverfahren verarbeitet. Diese Methode bündelt statistische Messgrößen wie gleitende Durchschnitte und Histogramme, die für die Validierung herangezogen werden. Die Firmware steuert eine Art Filterkette, die zwischen sofortigen Messwerten, anpassenden Mittelwerten und langfristigen Verteilungen differenziert.
Darüber hinaus analysiert die Firmware Korrelationen zwischen verschiedenen Sensoren, um sicheres Urteil über die Echtheit zu treffen. Die komplexe Datenverschmelzung verschiedener Optik- und Magnetsensoren erzeugt ein vielseitiges, schwer zu fälschendes Fingerabdruckprofil für jeden Geldschein. Trotzdem stellt sich die Frage: Könnte man die Signale so nachahmen, dass die Validatoren getäuscht werden? Erste eigene Versuche legten nahe, dass das reine Nachahmen einzelner Sensorwerte möglich sein könnte. Durch passgenaue Linienmuster, die mit den Laufsensoren synchronisiert wurden, konnten einzelne Signalkurven simuliert werden. Allerdings zeigt sich bei Mehrfachsensoren das Problem: Alle Sensoren müssen gleichzeitig exakt stimmen.
Auch kleine Abweichungen bei Papierart, Farbauftrag oder Oberflächenstruktur führen dazu, dass gemittelte Histogramme oder die Auto-Trim-Verfahren scheitern. Zusätzlich erschwert die Vielfalt der erfassten Spektralbereiche – sichtbares Licht, UV und IR – die Fälschung erheblich. Filme oder Druckfarben müssen ungewöhnlichen Materialeigenschaften entsprechen, um alle Sensoren zu beeindrucken. Zudem beeinflussen Gebäudebeleuchtung oder Umgebungslicht konstant das Messsignal, das die Firmware durch kalibrierte Schritte kompensiert. Eine verblüffende Entdeckung war, dass gedrucktes Papier mit speziellen Sprays, etwa Sonnencreme, bei manchen UV-Sensoren für ähnliche Reflexion wie echtes Banknotenpapier sorgen kann.
Doch dies reicht bei weitem nicht aus, um sämtliche Merkmale akkurat zu modellieren – das System bleibt in der Summe zu komplex. Man erkennt daran, wie differenziert und feinsinnig die Sensorumgebung kalibriert wird. Die Kombination von Deep-Diving in die Elektronik, mechanische Analyse der Bewegungsgeber und das Reverse Engineering der Firmware macht deutlich: Banknotengeräte sind clever gestaltete Systeme mit hervorragender Kosteneffizienz. Sie nutzen einfache Hardwarekomponenten, erreichen aber mit Software und präziser Signalverarbeitung eine unerwartet hohe Sicherheitsqualität. Die Erkenntnis daraus ist vor allem eines: Geldscheine sind weiterhin gut geschützt, auch wenn der erste Eindruck von simplen LED-Sensor-Paaren täuschen mag.
Die „low-tech“ scheint auf den ersten Blick ineffizient, in Wahrheit aber ist hier ein mehrdimensionales Zusammenwirken umgesetzt, das gezielte Fälschungsversuche äußerst schwierig macht. Aus technischer Sicht illustriert das Thema Banknotenprüfer faszinierend, wie Spezialhardware durch clevere Algorithmen unterstützt wird. Zudem verdeutlicht es, wie physikalische Herausforderungen der Materialien berücksichtigt werden müssen – was heute für viele Sicherheitsanwendungen zentral ist. Die geringe Verfügbarkeit von detailliertem Wissen macht Erkenntnisse dieser Art wertvoll und zeigt das Potential von Reverse Engineering auch in Bereichen, die zunächst unscheinbar wirken. Trotzdem, auch wenn die Forschung weitere Schwachstellen finden könnte, zeigt die hohe Komplexität des Systems, dass ein einfacher Angriff kaum erfolgversprechend ist.
Die integrierte Kombination aus unterschiedlichen Messprinzipien, mechanischen Kontrollelementen, dedizierter Firmware und der Vielzahl an Sicherheitsmerkmalen in Banknoten hat sich als sehr robust erwiesen. Für alle, die sich tiefer mit diesem spannenden Thema auseinandersetzen möchten, empfiehlt es sich, nicht nur Geräte zu analysieren, sondern auch die unterschiedlichen Arbeitsschritte bei der Banknotenerstellung und Sicherheitsdruckerei zu verstehen. Denn nur im Zusammenspiel von Banknoten und Validatoren lässt sich die tatsächliche Sicherheit bewerten. Letztlich bleibt festzuhalten: Das Fälschen von Geldscheinen ist nicht nur eine technische Frage, sondern auch eine von Wirtschaftlichkeit und Zugänglichkeit der nötigen Werkzeuge. Die aufwendige Sicherheitstechnik, die in Banknoten und Prüfern steckt, ist mindestens so beeindruckend wie die Herausforderungen bei der Nachahmung.
Das Wissen über die technischen Hintergründe interessanter Low-Tech-Produkte wie Banknotengeräte liefert somit wertvolle Einblicke in ein Thema, das in der öffentlichen Wahrnehmung häufig unterschätzt wird.



![Restoring Control over the Immigration System: Technical Annex [pdf]](/images/F2F50BC1-B4C6-4303-9BC0-1B470AD7ED9C)