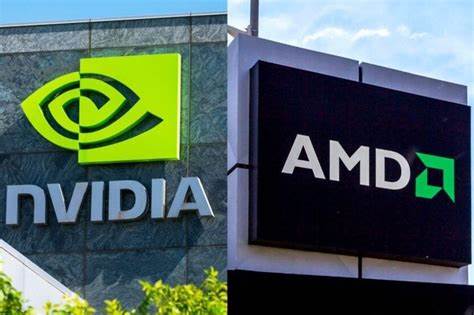In den letzten Jahren haben Visa und Mastercard als die dominierenden internationalen Zahlungskartensysteme eine markante Stellung auf dem europäischen Markt eingenommen. Rund zwei Drittel aller Kartenzahlungen im Euroraum werden über diese beiden US-amerikanischen Unternehmen abgewickelt. Trotz dieser dominanten Marktposition sorgen gerade ihre Gebühren und die fehlende Transparenz über diese Kosten zunehmend für Unmut, insbesondere bei Einzelhändlern und Onlinehändlern in der Europäischen Union. Jüngst haben die größten europäischen Einzelhandelsketten und Onlinehändler daher die Europäische Kommission aufgefordert, gegen diese Praktiken energisch vorzugehen, um das europäische Wirtschaftsumfeld zu schützen und zu stärken Die Kritik der Händler richtet sich vor allem gegen die stetig steigenden Gebühren, die sie an Visa und Mastercard zahlen müssen, sogenannte Interchange Fees oder ICS-Gebühren (International Card Schemes). Eine Untersuchung der Beratungsfirma The Brattle Group zeigt einen Anstieg dieser Gebühren um fast 34 Prozent zwischen 2018 und 2022 – und das zusätzlich zur allgemeinen Inflation.
Diese Gebührenerhöhungen seien nicht mit verbesserten Dienstleistungen oder innovativen Angeboten für Händler und Verbraucher in Europa verbunden. Im Gegenteil, die Händler beklagen, dass die Gebührenstrukturen komplex und intransparent sind. Durch diesen Mangel an Klarheit und die hohe Komplexität des Abrechnungssystems werden Händler faktisch daran gehindert, die Kosten nachzuvollziehen oder sich dagegen zu wehren. Der Einfluss der US-gestützten Kartenanbieter ist nicht nur ein wirtschaftliches Thema, sondern gewinnt auch eine politische Dimension: Die hinlänglich bekannten Bemühungen der EU, Alternativen wie die Einführung eines digitalen Euro voranzutreiben, sollen vor allem die Abhängigkeit von US-Anbietern reduzieren. Die schleppenden Fortschritte bei der Einführung einer digitalen Euro-Währung erhöhen jedoch den Druck auf die Kommission, bereits jetzt regulative Maßnahmen gegen Visa und Mastercard zu ergreifen, um den europäischen Binnenmarkt zu schützen und einen faireren Wettbewerb zu gewährleisten.
Die Forderungen der europäischen Einzelhändler wurden in einem umfassenden Schreiben an wichtige EU-Kommissare gerichtet, darunter an Teresa Ribera, die für Wettbewerbsrecht zuständig ist, ebenso wie an die Kommissarin für Finanzdienstleistungen Maria Luís Albuquerque und den Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis. Das Schreiben wurde von namhaften Lobbygruppen unterzeichnet, zu denen EuroCommerce, Ecommerce Europe, Independent Retail Europe, die European Association of Corporate Treasurers sowie die European Digital Payments Industry Alliance gehören. Diese Verbände vertreten eine breite Palette berühmter Einzelhandelskonzerne wie Aldi, Amazon, Carrefour, eBay, H&M, Ikea, Intersport, Marks & Spencer sowie wichtige Akteure der Zahlungsdienstleistungsbranche wie Worldline, Nexi und Teya. Im Kern fordern die Unterzeichner eine strengere Regulierung der Gebühren durch die EU-Kommission. Dazu solle die Höhe der Interchange Fees durch konkrete Preisobergrenzen begrenzt werden, um das Übermaß an Kosten für Händler abzumildern.
Gleichzeitig solle die Kommission im Rahmen der bestehenden Wettbewerbsregeln ein stärkeres Durchgreifen ermöglichen. Dazu gehört die Einrichtung von Mechanismen, mit denen Zahlungen und Gebührenstrukturen transparenter und besser nachvollziehbar werden, um Diskriminierungen und undurchsichtige Gebührenmodelle zu verhindern. Eine solche regulatorische Kontrolle soll sicherstellen, dass weder Visa noch Mastercard ihre marktbeherrschende Stellung missbrauchen können. Visa hat auf die Kritik reagiert und betont, dass die Gebühren ihre Leistungen widerspiegeln, die einen hohen Sicherheitsstandard, wirksame Betrugspräventionsmaßnahmen, nahezu perfekte Betriebsstabilität sowie eine Vielzahl innovativer Produkte und Verbraucherschutzmechanismen umfassen. Die Unternehmen argumentieren, dass diese Leistungen zu einem Mehrwert für Verbraucher und Händler in Europa führen.
Mastercard hingegen hat keine öffentliche Stellungnahme zu den aktuellen Vorwürfen abgegeben. Aus der Perspektive der europäischen Einzelhändler stellen die unregulierten und unverhältnismäßig hohen Gebühren jedoch ein zunehmendes Hemmnis sowohl für den stationären Handel als auch für den Onlinehandel dar. Gerade kleine und mittlere Unternehmen sehen sich durch die hohen Gebühren bei Kartenzahlungen einer erheblichen Kostenbelastung ausgesetzt, was ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber internationalen Wettbewerbern vermindert. Zudem könnte sich die Abhängigkeit von wenigen dominierenden Anbietern negativ auf die Innovationskraft und den Wettbewerb im europäischen Zahlungsmarkt auswirken. Die Debatte um die Regulierung der Zahlungssysteme und die Gebührenhöhe passt auch in einen größeren Kontext der europäischen Digitalstrategie und der wirtschaftspolitischen Bemühungen, Europas Souveränität im digitalen Zeitalter zu stärken.
Derzeit wird intensiv über die Einführung eines digitalen Euro diskutiert, der als staatliches Zahlungsmittel nicht nur die Abhängigkeit von US-amerikanischen Zahlungssystemen verringern, sondern auch neue Standards für Effizienz und Transparenz in den Bezahlprozessen setzen könnte. Angesichts der zögerlichen Fortschritte bei der Entwicklung und regulatorischen Festlegung für einen digitalen Euro sehen viele Marktteilnehmer jedoch die Notwendigkeit, kurzfristig andere Maßnahmen zum Schutz des Binnenmarktes zu ergreifen. Ein weiterer Aspekt der Kritik liegt in der fehlenden Transparenz und Komplexität der Gebühren. Die Händler beklagen, dass die Regeln und Preisgestaltungen der Kartenanbieter schwer nachvollziehbar seien. Dies erschwere es den Händlern, fundierte Entscheidungen über die Kosten und den Nutzen von Zahlungslösungen zu treffen.
Die erbetene Einführung von Kontrollinstrumenten für Regulierungsbehörden könnte hier Abhilfe schaffen und dazu beitragen, Preisgestaltungen für Händler nachvollziehbarer und fairer zu machen. Das wiederum könnte langfristig zu einer stärkeren Marktdynamik und einer breiteren Vielfalt an Zahlungsangeboten führen. Neben den potentiellen positiven Auswirkungen auf den Wettbewerb und die Verbraucherrechte könnten verschärfte Regulierungen auf europäischer Ebene auch geopolitische Bedeutung erlangen. In einer zunehmend digitalisierten und globalisierten Wirtschaft ist die Kontrolle über kritische digitale und finanztechnologische Infrastrukturen für die wirtschaftliche und politische Souveränität von großer Bedeutung. Die Herausforderung besteht darin, einen Ausgleich zu finden zwischen international integrierten Zahlungsdiensten und dem Schutz der eigenen Wirtschaftsinteressen.
Abschließend lässt sich sagen, dass die jüngsten Forderungen der europäischen Einzelhändler gegenüber der Europäischen Kommission ein deutliches Signal aussenden. Es zeigt sich, dass der aktuelle Status quo bezüglich der Kontrolle der Gebühren und Marktpraktiken von Visa und Mastercard für viele Akteure unbefriedigend ist und weitreichende Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Marktes hat. Die anstehenden regulatorischen Entscheidungen werden folglich nicht nur den Zahlungsverkehr, sondern auch den Handel und die digitale Wirtschaft in Europa maßgeblich prägen. Die nächsten Monate werden zeigen, wie die EU-Kommission auf diesen zunehmenden Druck reagieren wird und welche Maßnahmen sie ergreift, um die Vormachtstellung der großen internationalen Zahlungskartennetzwerke zu überprüfen und gegebenenfalls zu regulieren.