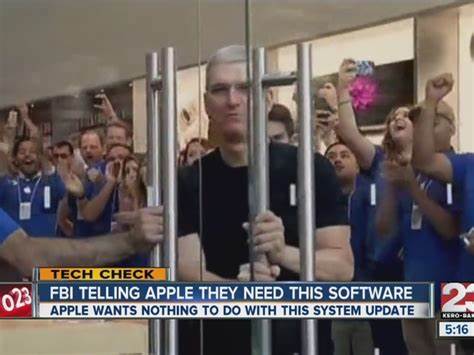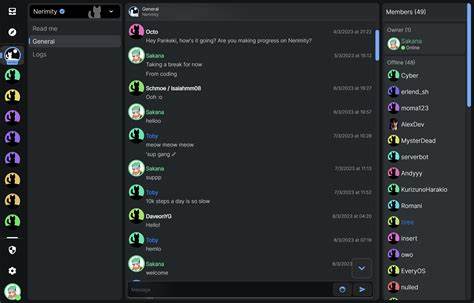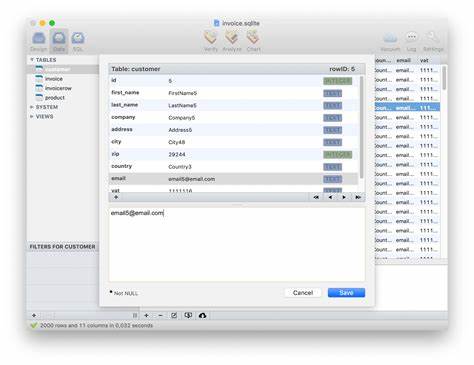The Ting Tings sind ein Duo aus Salford, das mit ihrem Debütalbum 2008 und dem Hit "That's Not My Name" einen fulminanten Einstand feierte. Die Geschichte ihres zweiten Albums, "Sounds from Nowheresville", erschienen 2012, ist ein faszinierendes Beispiel für die Schwierigkeiten, denen sich Künstlerinnen und Künstler in der Musikbranche oft gegenübersehen. Katie White und Jules de Martino, die kreative Seele hinter dem Duo, führten ihren ganz eigenen Kampf – gegen Erwartungen, gegen künstlerische Kompromisse und nicht zuletzt gegen das System, dem sie sich ausgeliefert fühlten. Der Erfolg ihres ersten Albums war überwältigend und katapultierte The Ting Tings in den internationalen Musikzirkus. Doch mit dem Ruhm kamen auch die Erwartungen.
Während "We Started Nothing" durch seinen rohen, spontanen Charme bestach, der zum großen Teil aus einer Phase ausgelassener Partys in ihrer Heimatstadt Salford stammte, verlief die Produktion des Nachfolgers deutlich komplexer. Die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Album war geprägt von Endlosigkeit, Selbstzweifeln und der Suche nach neuer Inspiration – Phasen, die viele Musiker kennen, aber nur wenige so offen eingestehen. Die Band entschied sich, ihr zweites Album in einem Keller in Berlin aufzunehmen, einem Ort, der für sie zum Symbol des Neuanfangs werden sollte. Der Einfluss der Berliner Club- und Technoszene, die für ihren pulsierenden Sound und unkonventionellen Ansatz bekannt ist, spielte eine zentrale Rolle bei der Entstehung vieler Songs. Dennoch führte genau diese Verbindung zwischen dem Entstandenen und den Erwartungen des Labels zu Konflikten.
Die Plattenfirma sah in den tanzlastigen Stücken eine großartige Gelegenheit, den kommerziellen Erfolg des Debüts zu wiederholen oder sogar zu übertrumpfen. Aus Sicht der Künstler fühlte es sich jedoch eher wie eine Falle an, ein Vorherbestimmtsein, mit dem sie so nicht einverstanden waren. Darin liegt das zentrale Problem, dem sich das Duo stellte: die unüberbrückbare Kluft zwischen eigener künstlerischer Vision und kommerziellem Druck. Während die Vorstellungen der Labelvertreter oft vorhersehbar und auf schnellen Erfolg gemünzt waren, suchten White und de Martino nach Tiefe und Glaubwürdigkeit in der Musik. Das führte schließlich zu der radikalen Entscheidung, die bereits aufgenommenen Songs zu löschen – eine mutige, aber riskante Geste.
Damit riskierten The Ting Tings nicht nur das Vertrauen ihres Labels, sondern auch ihre Karriere. Dieses Vorgehen ist nicht nur ein Beleg für ihre Integrität, sondern auch für die Zerbrechlichkeit von musikalischen Karrieren und den Druck, der auf Künstlerinnen und Künstler lastet. Beeindruckend ist, wie offen die beiden über diese Zeit sprach. Ihre Geschichte illustriert, wie eng Erfolg und persönliches Leid oft miteinander verknüpft sind. White und de Martino erklärten, dass sie ihre besten Songs nur schreiben können, wenn sie sich in einem Zustand der Verzweiflung oder in einem emotional herausfordernden Moment befinden.
Glückliche Künstler liefern ihrer Meinung nach selten authentische Musik. Das ist ein grundlegender Gedanke, der im Musikbusiness nicht oft so klar benannt wird und der viele Fans hinter ihre Songs blicken lässt. Der Druck durch das Label, die komplizierten Erwartungen der Industrie und der mediale Hype wirken häufig erdrückend. The Ting Tings schafften es dennoch, sich Freiräume zu bewahren und ihre Art, Musik zu machen, zu verteidigen. Dabei half ihnen sicherlich ihre Vorgeschichte: Bevor sie als The Ting Tings Erfolg hatten, standen sie bereits mit verschiedenen Bands am Rand des Mainstreams und hatten hautnah erlebt, wie destruktiv das Musikgeschäft sein kann.
Bei Dear Eskiimo wurden sie abgelehnt, von ihrer ersten Band TKO abgewiesen und hatten mit dem Boy-Band-Projekt Tomkat wenig Freude. Diese Erfahrungen haben sie geprägt und zu kompromisslosen Künstlern werden lassen, die sich weigerten, sich der Maschine Musikindustrie vollständig zu unterwerfen. Der Erfolg von "That's Not My Name" trägt eine bittersüße Note. Der Song entstand aus einer Phase der Frustration, geprägt von einem Gefühl der Unsichtbarkeit und der Enttäuschung nach dem Scheitern ihrer vorherigen Projekte. Mit seinem unwiderstehlichen Hook und der ansteckenden Energie wurde er zum Statement und zur Hymne für diejenigen, die sich übersehen fühlten.
Doch Erfolg brachte auch Belastungen: Das Duo musste unzählige Interviews führen, auf großen Bühnen spielen und sich den Anforderungen eines strengen Tourplans stellen. Der Druck führte zu Spannungen, bis hin zu handfesten Auseinandersetzungen zwischen White und de Martino. Der Wendepunkt kam, als White nach einer Überdosis Antibiotika während einer US-Tour zusammenbrach und ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Das war ein drastischer Weckruf, der das Duo zwang, eine Pause einzulegen und sich neu zu orientieren. Die Arbeit am zweiten Album wurde für sie zur Möglichkeit, diese Erschöpfung und den emotionalen Ballast zu verarbeiten, aber auch zum Zeichen von Kontrollverlust – und erneut zum Beweis dafür, wie zerbrechlich kreative Prozesse sein können.
Die Entscheidung, ihr zweites Album erst Jahre nach dem Debüt zu veröffentlichen, führte zu Spekulationen und einer gewissen Ungeduld bei Fans und Kritikern. Doch The Ting Tings blieben ihrem Prinzip treu. Für sie war die Musik mehr als ein Produkt, sie war ein Ausdruck persönlicher Erfahrungen und innerer Welten. Das zeigt auch die Art und Weise, wie sie sich gegen typische Labelentscheidungen stellten – von der Ablehnung eines teuren Musikvideos bis zur Weigerung, bestimmte Demoaufnahmen zu veröffentlichen. Mit einem Augenzwinkern beschrieben sie sich als "Kontrollfreaks", was ihre akribische Haltung zur eigenen Kunst und zum Umgang mit der Öffentlichkeit unterstreicht.
Ihre eigene Skepsis gegenüber den Mechanismen der Musikindustrie spiegelt sich auch in ihren Äußerungen zur Online-Videoveröffentlichung wider. Während viele Künstler Videoclips strategisch über Plattformen wie Vevo debütieren lassen, setzten die Ting Tings ihren Lead-Song "Hang It Up" einfach selbst auf YouTube, was als provozierend und eigenwillig betrachtet wurde. Die Band zeigte damit, dass sie nicht nur musikalisch, sondern auch in puncto Selbstvermarktung ihre eigenen Wege ging – was in der heutigen digitalen Zeit ein wichtiger Bestandteil der Künstleridentität ist. Auf persönlicher Ebene ist die Beziehung zwischen Katie White und Jules de Martino ebenfalls interessant. Obwohl alle Welt vermutete, sie seien ein Paar, betonten sie stets, dass sie nur musikalische Partner und Freunde sind.
Diese tiefe, aber nicht romantische Bindung ermöglichte ihnen eine kreative Dynamik, die über die Jahre Bestand hatte. Die Arbeit am gemeinsamen Projekt war für sie alles umfassend, fast obsessiv. Für Beziehungen außerhalb der Band blieb kein Raum. Diese Hingabe spiegelte ihre kompromisslose Haltung zum Musikmachen wider und war ein Motor, der sie antreibt und belastet zugleich. Trotz aller Schwierigkeiten brachten The Ting Tings mit "Sounds from Nowheresville" ein Album heraus, das eine Mischung aus eingängigen Popmelodien und experimentellen Klub-Sounds bot.
Four der ursprünglichen Berlin-Sessions fanden den Weg zurück aufs Album, getreu dem Motto, dass trotz all der Zweifel und Neuorientierungen ihre Ursprünge nicht gänzlich verloren gehen sollten. Das Album zeigt mit seinen kapriziösen Wechseln zwischen Hoch- und Tiefpunkten die Ambivalenz wider, die das Duo damals empfand – zwischen dem Wunsch nach Kommerzialisierung und dem Bedürfnis nach künstlerischer Freiheit. Die Reaktionen der Öffentlichkeit fielen gemischt aus. Einige Kritiker lobten den Mut und die Vielfalt, andere vermissten den klaren Hitcharakter des ersten Albums. Doch The Ting Tings erklärten selbstbewusst, dass es ihnen nicht darum ging, neue "Hits" zu schreiben oder alte Erfolge zu wiederholen.
Vielmehr wollten sie ehrlich bleiben und Risiken eingehen. Lieber selbst scheitern, als sich der Industrie und ihren Zwängen völlig zu unterwerfen – das war ihr Leitmotiv. Das Beispiel der Ting Tings zeigt exemplarisch, wie schwierig der Weg für Bands ist, nach einem großen Erfolg die Erwartungen zu erfüllen und gleichzeitig die kreative Kontrolle zu bewahren. Der Spagat zwischen künstlerischer Integrität und kommerziellem Druck ist eine Gratwanderung, die viele junge Künstler zum Verzweifeln bringt. Manche geben nach, andere treten den Rückzug an.
The Ting Tings entschieden sich für den Kampf, auch wenn dieser ihre Karriere auf's Spiel setzte. In der heutigen Musiklandschaft hat sich vieles verändert. Streamingdienste, Social Media und veränderte Hörgewohnheiten bieten zwar neue Möglichkeiten, erhöhen aber auch den Druck und die Schnelllebigkeit. Künstler müssen immer wieder beweisen, dass sie relevant bleiben, während sie gleichzeitig ihre Authentizität bewahren wollen. Die Erfahrungen von The Ting Tings erscheinen in diesem Kontext wie eine Mahnung und ein Plädoyer für mehr Geduld, Vertrauen und Respekt vor der Kunst.
Als Fazit lässt sich festhalten, dass The Ting Tings mit ihrem schwierigen zweiten Album einen wichtigen Beitrag zur Diskussion über die Herausforderungen moderner Musikerinnen und Musiker geleistet haben. Ihr Mut, um zu kämpfen, und ihre Weigerung, den bequemen Erfolg um jeden Preis zu sichern, machen sie zu einem bemerkenswerten Beispiel in der Popwelt. Für Fans und Beobachter bleibt ihre Geschichte eine spannende Lektion über die Freiheit, die Kosten hat, und darüber, wie wichtig es ist, der eigenen Stimme treu zu bleiben – auch wenn der Weg steinig ist.