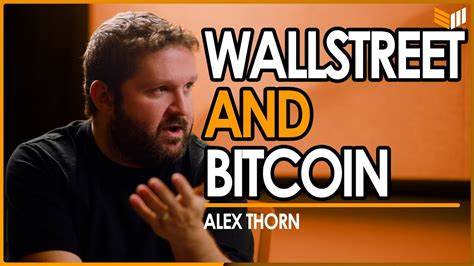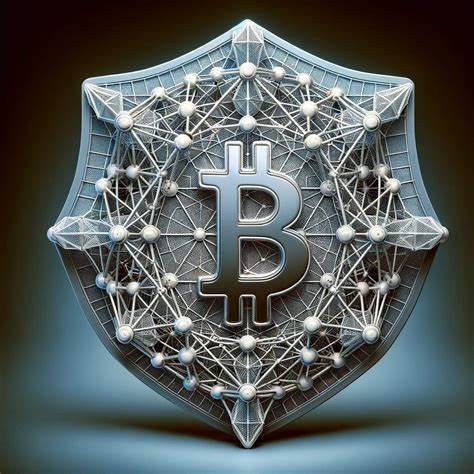In den letzten Jahren hat sich Künstliche Intelligenz (KI) zu einer Schlüsseltechnologie entwickelt, deren Einfluss auf verschiedenste Wirtschaftsbereiche als revolutionär prognostiziert wird. Besonders Sprachmodelle wie GPT-4 gelten als bahnbrechende Werkzeuge, die menschliche Kenntnisse effektiv ersetzen oder ergänzen können. Trotz der schnellen Verbreitung und der scheinbar grenzenlosen Verfügbarkeit von Informationen in Entwicklungsländern bleibt eine unerwartete Frage bestehen: Warum spiegelt sich der technologisch bedingte Zugewinn an Wissen nicht in einem deutlichen Wachstum der Volkswirtschaften wider? Dieser sogenannte „Token-Paradoxon“ wirft ein Licht auf komplexe ökonomische Realitäten und begrenzt die optimistischen Erwartungen an die unmittelbare Wirkung von KI auf gesellschaftlicher Ebene. Ein Vergleich mit früheren Bildungsmilieus und technologischen Revolutionen schafft eine wichtige Einordnung, warum mehr Wissen keineswegs automatisch zu besserem wirtschaftlichen Output führt. Die Ausgangsbasis für die Annahme, dass KI das Wachstum antreibt, beruht auf der Rolle von menschlichem Kapital und Intelligenz als Motoren ökonomischer Entwicklung.
In arbeitsmarktbezogenen Studien konnte vielfach gezeigt werden, dass Bildung und intelligente Strategien die Einkommenssituation von Individuen verbessern können. Beim Blick auf Unternehmen internationaler Märkte wird deutlich, dass gezielte Wissenserweiterung oft zu einer höheren Produktivität und Gewinnsteigerung führt. Praktische Beispiele aus unterschiedlichen Regionen zeigen, dass selbst relativ einfache Maßnahmen wie Beratungsprogramme oder Erinnerungen per Textnachricht für Bauern bereits messbare Effekte auf Erträge bewirken können. Diese mikroökonomischen Befunde sind die Grundlage für die verbreitete Annahme, dass Informations- beziehungsweise Wissenszugang und -verbreitung in größerem Maßstab ein entscheidender Faktor für nachhaltiges Wachstum sind. Der Siegeszug von KI-gestützten Sprachmodellen wie ChatGPT repliziert und erweitert theoretisch das menschliche Wissen in einer Form, die leicht zugänglich ist und viele bisher zeitintensive Prozesse automatisiert.
Die Fähigkeit solcher Systeme, komplexe akademische Prüfungen zu bestehen oder professionelle Aufgaben in Medizin und Programmierung zu erledigen, demonstriert, dass sie den menschlichen Intellekt zumindest in Teilbereichen übertreffen können. Zudem lässt sich mit Nutzerzahlen aus Ländern wie Indien, Madagaskar oder den Philippinen belegen, dass gerade in vielen Entwicklungsländern der Zugang zu solchen Modellen sehr weit verbreitet ist. Dort zählen KI-Angebote mittlerweile zu den meistgenutzten Online-Plattformen. Trotz dieser eindrucksvollen Verbreitung und praktischer Leistungsfähigkeit steht das wirtschaftliche Wachstum in diesen Regionen verhältnismäßig stagnierend da. Das überrascht insofern, als die theoretische Grundannahme lautet, dass Wissenszugang und steigende kognitive Kapazitäten unmittelbar zu produktiveren Unternehmen und höheren Einkommen führen sollten.
Die Paradoxie erinnert an historische Beobachtungen aus der Bildungsforschung, etwa Lant Pritchetts Frage „Where has all the education gone?“, die aufzeigte, dass gesteigerte Bildungsjahre in der Vergangenheit nicht zwangsläufig in überproportionalem Wirtschaftswachstum resultierten. Um diesen Widerspruch zu verstehen, ist es wichtig, verschiedene Erklärungsperspektiven zu berücksichtigen. Ein naheliegender Ansatz ist, dass die Implementierung von KI im Alltag und in der Wirtschaft schlichtweg noch nicht ausreichend vorangeschritten ist. Wie bei früheren Innovationen, etwa der Bahn oder dem Automobil, können transformative Effekte erst über Jahre oder gar Jahrzehnte messbar werden. Technologische Verfügbarkeiten allein sind kein Garant für unmittelbare Produktivitätssteigerungen, da Unternehmen und Nutzer erst lernen müssen, wie sie KI optimal einsetzen.
Die Herausforderungen des Zugangs zu geeigneten Geräten, einer stabilen Internetinfrastruktur sowie der organisatorischen Umstrukturierung dürfen dabei nicht unterschätzt werden. Ebenso könnte es sein, dass der „Fragestil“ und die Nutzungskompetenz der Bevölkerung nicht an den idealen Umgang mit KI angepasst sind. Das Verstehen, welche Fragen überhaupt gestellt werden sollten, um qualitativ hochwertige Antworten zu erhalten, ist keine Selbstverständlichkeit. Gerade Nutzer ohne formale Bildung oder technisches Know-how könnten Mühe haben, das volle Potenzial der KI auszuschöpfen. Studien zeigen, dass selbst unter Personen mit technischem Zugang die Fähigkeit, KI als Beratungsinstrument richtig einzusetzen, begrenzt ist.
Das Lernen dieser Fähigkeit ähnelt einer neuen Form der Bildung, die jedoch bislang nicht breit vermittelt wird. Ein weiterer Aspekt betrifft die Überfülle an Informationen und Entscheidungen, mit denen kleine Unternehmen oder landwirtschaftliche Betriebe täglich konfrontiert sind. Es scheint unpraktisch, in jedem einzelnen kleinen Schritt tiefgreifend KI-gestützte Ratschläge einzuholen – zu zeitaufwendig und häufig zu komplex für den Alltag. Daraus folgt, dass trotz Zugriff auf ein „Orakel“ aus Wissen die Zeitressourcen und die kognitive Last der Nutzer eine Rolle spielen, die das Wachstumspotenzial dämpfen. Hinzu kommt, dass viele der Informationen, die heute durch KI-Systeme zugänglich gemacht werden, schon vorher weitverbreitet waren.
Plattformen wie YouTube, Google oder Wikipedia ermöglichten schon vor dem Aufkommen ausgefeilter Sprachmodelle eine breite Zugänglichkeit zu Wissen. Die marginalen Verbesserungen, welche neue KI-Modelle bringen, könnten daher im Vergleich zu den bestehenden Zugangsmöglichkeiten relativ gering sein. Das erklärt, warum sich ein Zuwachs an kognitiven Ressourcen nicht automatisch in messbare Produktivitätszuwächse übersetzt. Die institutionellen Rahmenbedingungen spielen ebenfalls eine bedeutende Rolle. In vielen Entwicklungsländern behindern bürokratische Hindernisse, Korruption und mangelnde Rechtssicherheit das wirtschaftliche Wachstum viel stärker als mangelnde Intelligenz oder Informationsdefizite.
Ein Unternehmen kann eine höchst ertragreiche Idee oder Technologie besitzen, doch wenn es an verlässlichen Vertragsmechanismen, funktionierenden Märkten oder Investitionsschutz mangelt, wird das wirtschaftliche Potenzial nicht realisiert. Daraus folgt, dass Intelligenz allein nicht das Wachstum befördert, sondern nur in Kombination mit stabilen institutionellen Strukturen zum Tragen kommt. Wohlhabende Länder könnten gerade aufgrund solcher effizienter Institutionen erfolgreicher sein, auch wenn die Differenz im menschlichen Kapital auf vergleichbarem Niveau liegt. Selbst die oft als Schlüssel zur Prosperität betrachtete Bildung zeigt sich in einem anderen Licht, wenn man sie als Signalisierung statt als direkten Produktivitätsfaktor interpretiert. Die Vermittlung von Wissen in Bildungseinrichtungen kann zumindest partiell den Zweck erfüllen, soziale Fähigkeiten, Anpassungsfähigkeit und Status zu vermitteln, statt unmittelbar ökonomisch verwertbare Kompetenzen.
Dabei fällt auf, dass es viele hochgebildete Menschen mit hohem Intellekt gibt, die dennoch kein überdurchschnittliches Einkommen erzielen, etwa Lehrer oder Wissenschaftler. Umgekehrt erzielen oft Personen mit beschränkter formaler Bildung aber großartige wirtschaftlichen Erfolg, was darauf hinweist, dass neben Intelligenz auch soziale Kompetenz, Durchsetzungsvermögen und andere Faktoren wesentlich sind. Ein kritischer Punkt betrifft auch die Auswirkungen von Automatisierung und KI auf den Arbeitsmarkt. Die Leistungsfähigkeit von KI führt nicht zwangsläufig zu einem Wachstum, das allen Wirtschaftsteilnehmern zugutekommt. Vielmehr kann Automatisierung Arbeitsplätze verdrängen und Einkommen von bestimmten Gruppen auf Kosten anderer verringern.
Insbesondere in preisgünstigen Dienstleistungssektoren wie Callcentern wurde beobachtet, dass KI das Volumen der menschlichen Arbeit reduziert. Die Gewinne landen dabei oft bei großen Technologieunternehmen in den Industrieländern, während Entwicklungsländer langfristig weniger profitieren oder gar Verluste entstehen. Betrachtet man alle diese Facetten, wird klar, dass der bloße Zugang zu intelligenter Technologie nicht zwangsläufig in ökonomischem Wachstum resultiert. Die Komplexität von Wachstum widerspricht der Vorstellung eines simplen Zusammenhangs zwischen Wissen und Wohlstand. Vielmehr wirkt eine Reihe sozioökonomischer und institutioneller Faktoren zusammen, die genau bestimmen, ob technologische Innovationen Wirkungen zeigen.
So stehen wir am Anfang der Nutzung von KI in der breiten Bevölkerung, insbesondere in Entwicklungsländern. Die bisherigen Veränderungen sind vielversprechend, aber auch gedämpft. Die Herausforderung liegt darin, neben der Weiterentwicklung der Technologie auch Zugangsbarrieren abzubauen, Bildung im Umgang mit KI-Werkzeugen zu fördern, institutionelle Rahmenbedingungen zu verbessern und die sozioökonomischen Folgen der Automatisierung sozial ausgewogen zu gestalten. Welche Rolle KI in Zukunft für ökonomisches Wachstum spielen wird, hängt somit maßgeblich davon ab, wie diese Begleitprozesse gestaltet und vorangetrieben werden. Das „Wo sind all die Tokens geblieben?“-Paradoxon bleibt eine Einladung an Wissenschaftler, Politik und Wirtschaft, tiefer zu analysieren, wie Wissen, Intelligenz und Technologie zusammenwirken.
Es fordert uns heraus, Erwartungen an Technologie nicht blind zu setzen, sondern sie im komplexen Kontext menschlicher Gesellschaften zu verorten. Nur so werden wir in der Lage sein, das tatsächliche Potenzial von KI zu entfalten und eine inklusive, nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen.