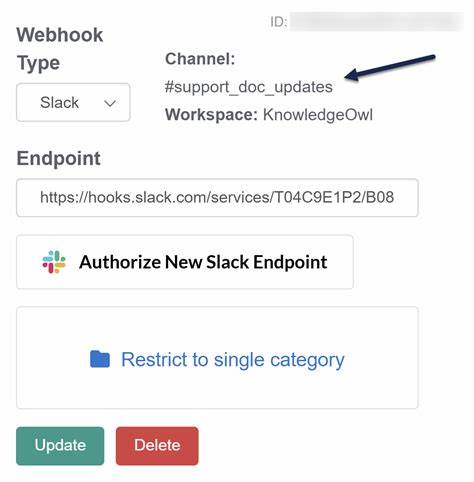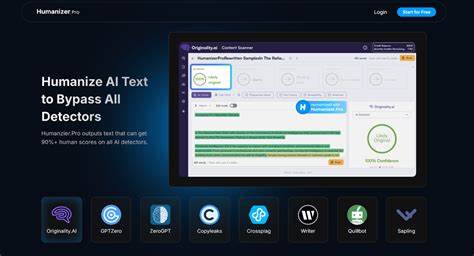Python gilt als eine der benutzerfreundlichsten und zugleich mächtigsten Programmiersprachen unserer Zeit. Sie überzeugt durch klare Syntax, umfangreiche Bibliotheken und eine lebendige Community. Doch was passiert, wenn man all diese Vorzüge gekonnt ignoriert und stattdessen versucht, den schlechtesten Python-Code aller Zeiten zu schreiben? Ganz genau: Es entsteht ein humorvoller Spiegel dessen, was man auf keinen Fall tun sollte, zugleich aber ein wertvolles Lehrstück für Entwickler ist. Ein absichtlich schlecht geschriebener Python-Code zeigt uns mit Augenzwinkern, wie man seine eigenen Projekte so unleserlich, ineffizient und fehleranfällig gestaltet, dass der eigene Code nach wenigen Wochen niemand mehr versteht – inklusive dem Autor. Zentraler Bestandteil dieser „Kunst“ ist unter anderem die Verwendung kryptischer Variablennamen, die den Code in ein Rätsel verwandeln.
Statt aussagekräftiger Bezeichner setzen schlechte Programmierer auf Ein-Buchstaben-Variablen, Mehrfachverwendungen derselben Namen in unterschiedlichen Funktionen und generische Begriffe wie data1, thing oder temp. Das bringt nicht nur Verwirrung, sondern garantiert stundenlanges Debugging in unübersichtlichem Gelände. Ein weiterer Klassiker ist das Importieren von allen verfügbaren Modulen auf allen Ebenen des Codes. Dabei werden Pakete wahllos eingefügt, mal ganz oben, mal mitten im Programm, wodurch es zu Überschneidungen und überraschenden Fehlern kommen kann. Ganz nebenbei verwandelt sich die Importsektion in ein Sammelsurium, in dem sich wichtige Bibliotheken irgendwo im Dschungel aus Zeilen verstecken – eine wahre Schatzsuche für jeden, der den Code warten möchte.
Die Funktionen schlechthin in schlechtem Code sind ebenfalls bemerkenswert. Statt sich an die bewährten Prinzipien der klar umrissenen Aufgabe zu halten, verfolgt man hier die Methode des „Alles-Könners“. Eine einzige Funktion übernimmt Validierung, Datenreinigung, E-Mail-Versand, Datenbankaktualisierung, Report-Generierung und darüber hinaus noch Analysen. Das Ergebnis ist gewaltiger Code, der weder modular noch leicht testbar ist – ein wahrer Albtraum in Wartungsszenarien. Auch der Umgang mit Fehlern und Ausnahmen reflektiert das humorvolle Konzept.
Fehler werden entweder völlig ignoriert oder auf eine Weise behandelt, die jegliche sinnvolle Reaktion ausschließt. Fehlermeldungen verschwinden im Nichts oder bestätigen sogar fälschlicherweise Erfolge. Diese Haltung gegenüber Exception Handling fördert eine besonders chaotische Laufzeitumgebung mit einem Hauch von kontrolliertem Wahnsinn. Kommentare? Wer braucht die schon! Im schlimmsten Python-Code verzichtet man auf jegliche Erläuterungen, idealerweise wird der Programmcode in verschachtelten Listenkomprehensionen oder Lambda-Ausdrücken verfasst, die selbst versierte Entwickler ratlos zurücklassen. Eine solche Praxis stellt eine Herausforderung für alle dar, die versuchen, den tieferen Sinn und die Funktionsweise der Algorithmen zu verstehen.
Globale Variablen sind ein weiterer Liebling der schlechten Programmierer. Wo Parameter sinnvoll wären, greift man stattdessen wahllos auf globale Zustände zurück, die von verschiedenen Funktionen manipuliert werden. Dies führt zu unerwarteten Nebeneffekten und einem extrem schwer nachvollziehbaren Programmfluss. Das Debuggen wird so zur bedeutenden Abenteuerreise. Anstatt moderne String-Formatierungsmethoden wie f-Strings oder .
format() zu nutzen, setzen schlechte Coder bevorzugt auf einfache, aber fehleranfällige Konkatenationen. Das bringt zwar Spaß durch potenzielle SQL-Injection-Szenarien, ist aber ein Paradebeispiel für unsicheren und unübersichtlichen Code. Wo Performance eigentlich ein wichtiges Thema ist, wird hier ganz gezielt darauf verzichtet. Alle Suchvorgänge erfolgen per Brute Force, Datenmengen werden ohne Rücksicht auf Effizienz komplett durchlaufen. Das Ergebnis ist geringer Durchsatz, hohe Latenzzeiten und die Sicherheit, dass Hardware immer mehr belastet wird – ein unerwarteter Beitrag zur Wirtschaft der Serverindustrie.
Konfigurationsparameter werden beliebig im Code verteilt, häufig mehrfach und widersprüchlich deklariert. Hardcoding ist Trumpf, Umgebungsvariablen und externe Konfigurationsdateien sind verpönt. Das Ergebnis ist eine verworrene Mischung, die das Vorgehen zum Verwalten und Aktualisieren von Einstellungen zur Qual macht. Nicht zu unterschätzen ist zudem die Freude am ungehemmten Copy-Paste. Statt Funktionen zu modularisieren, wird der gleiche Code episch oft mit minimalen Variationen kopiert.
Der daraus resultierende Pflegeaufwand sorgt dafür, dass Fehler in der einen Version zu Bugs in gleich mehreren Kopien führen – ein Garant für nachhaltigen Wartungsstress. Der Versuch, bewährte Bibliotheken zu meiden und stattdessen alles neu zu erfinden, fehlt in diesem humorvollen Leitfaden natürlich ebenfalls nicht. Eigene Versionen von HTTP-Clients, CSV-Parsers, Datumsfunktionen und sogar Hash-Algorithmen werden mit liebevollem Unvermögen umgesetzt. Wer will schon stabile, dokumentierte Open-Source-Lösungen, wenn man stattdessen unzählige Stunden damit verbringen kann, die gleichen Probleme aus einem anderen Blickwinkel neu zu lösen? Auch der bewusste Verzicht auf moderne IDEs und deren Funktionen gehört zum schlechten Programmierstil. Syntax-Highlighting, Auto-Completion, Fehlererkennung und Codeformatierung sind nur Hilfsmittel für Schwächlinge, so lautet das Motto.
Stattdessen schreibt man den Code in einfachen Texteditoren, mit vielen Tippfehlern und ohne jegliche automatische Unterstützung. Die „Freude“ am Auffinden von Fehlern erst zur Laufzeit ist daher garantiert. Sogar die Nutzung von KI-Unterstützung für das Codieren wird als niederträchtig abgelehnt. Automatisierte Vorschläge, schnelle Fehlervermeidung und intelligentes Refactoring gelten hier als Verlust der „echten“ Programmiererleidenschaft. Wer möchte schon effizient arbeiten, wenn schmerzhafte Stunden mit der manuellen Eingabe und mühseligen Lösungen möglich sind? Und selbstverständlich ist übliches Testen ein Punkt, den man bei schlechtem Python-Code ignoriert.
Unit-Tests, Integrationstests oder gar End-to-End-Tests werden belächelt. Der wahre Test findet live in der produktiven Umgebung statt – vorzugsweise dann, wenn die schlimmsten Nutzeranfragen eintreffen. Zusammengefasst ist das absichtlich schlechte Programmieren eine Kunst, die zeigt, wie man Python auf eine Weise missbrauchen kann, die sowohl Verwirrung als auch Lachen erzeugt. Es ist eine humorvolle und zugleich ernste Erinnerung daran, warum gute Programmierpraktiken unverzichtbar sind. Wer die Tricks dieser „Anti-Helden“ versteht, erkennt viel besser, wie sauberer und effizienter Code aussehen kann – und warum man sich von solchen „Verführungen“ fernhalten sollte.
Letztlich ist dieser Stil zwar mit Augenzwinkern gemeint, doch er motiviert Entwickler, immer bewusst und mit Bedacht zu programmieren. Klare Namen, strukturierte Funktionen, sinnvolle Fehlerbehandlung, moderne Werkzeuge und eine vernünftige Teststrategie sind Säulen guter Softwareentwicklung. Nicht zuletzt erleichtern sie die Zusammenarbeit im Team und sichern langfristig den Erfolg von Projekten. Wer also nach Inspiration sucht, wie man es auf gar keinen Fall machen sollte, kann sich an den beschriebenen Beispielen erfreuen und sorgenfrei lachen. Zugleich bietet der Blick auf diese stilistischen Fauxpas die Möglichkeit, das eigene Programmierverhalten zu hinterfragen und zu verbessern.
Humor und Lernen liegen eben oft nah beieinander – gerade in der Welt des Programmierens.
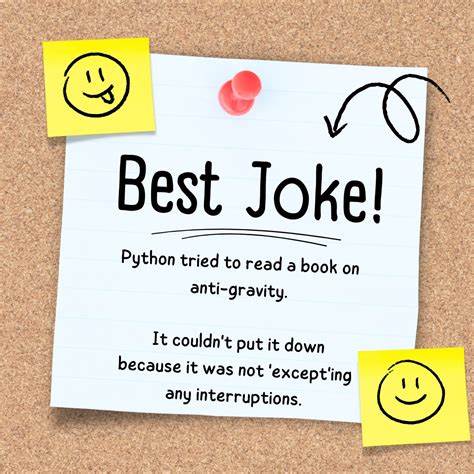


![[video] New ways to interact with windows in iPad OS](/images/FBB3EFC8-E5F5-4988-83B3-63FA82B8045D)