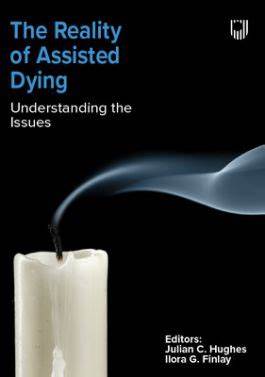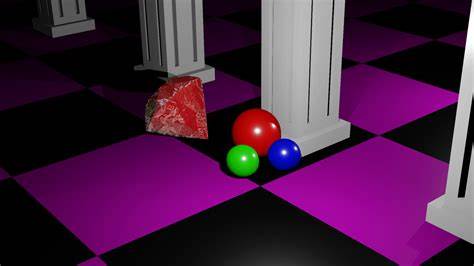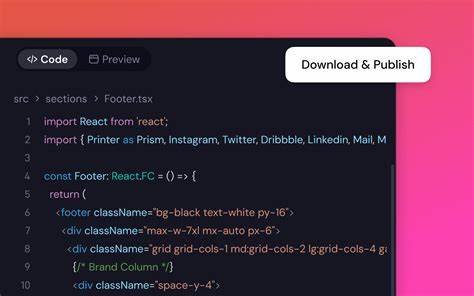Der 3D-Druck hat sich in den letzten Jahren zu einer revolutionären Technologie entwickelt, die im privaten, Bildungs- und Industriebereich breite Anwendung findet. Trotz der vielfältigen Vorteile häufen sich Studien, welche die potenziellen Gesundheitsrisiken der beim Drucken entstehenden Emissionen hervorheben. Die Umweltbehörde der Vereinigten Staaten (EPA) hat umfangreiche Untersuchungen zu den im 3D-Druckprozess freigesetzten Substanzen durchgeführt, um deren Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit besser zu verstehen und Sicherheitsmaßnahmen abzuleiten. Während des 3D-Druckens werden verschiedene Chemikalien und feinste Partikel ausgestoßen, welche potenziell schädlich sein können. Dazu gehören flüchtige organische Verbindungen, die als VOCs (Volatile Organic Compounds) bezeichnet werden und Teil der vom Drucker abgegebenen Gase sind.
Einige VOCs sind nachweislich gesundheitsschädlich, vor allem wenn sie eingeatmet werden. Neben diesen gasförmigen Verbindungen entstehen ultrafeine Partikel, deren Durchmesser zwischen einem und hundert Nanometern liegt. Diese Partikel sind so klein, dass sie tief in die Atemwege eindringen und sich dort ablagern können, was die gesundheitlichen Risiken zusätzlich erhöht. Die Quelle dieser Emissionen ist in erster Linie das Filament, das als Druckmaterial dient. Filament ist ein thermoplastischer Werkstoff, der während des Druckprozesses teilgeschmolzen wird, um das dreidimensionale Objekt Schicht für Schicht zu formen.
Die beiden dominierenden Filamentarten sind Polymilchsäure (PLA) und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS). PLA basiert auf nachwachsenden Rohstoffen wie Mais und gilt als umweltfreundlicher, da es biologisch abbaubar ist und die Emission von Treibhausgasen im Nutzungsprozess reduziert. ABS hingegen ist erdölbasiert und wird wegen seiner chemischen Beständigkeit vor allem in industriellen Anwendungen bevorzugt. EPA-Forscher konnten in ihren Studien belegen, dass die Emissionsmengen an Partikeln stark vom verwendeten Filamenttyp abhängen. PLA-Filamente setzen tendenziell weniger gesundheitsgefährdende Substanzen frei als ABS, dennoch ist auch PLA nicht emissionsfrei.
Besonders bei längerer oder intensiver Nutzung können sich Schadstoffe in geschlossenen Räumen anreichern, was die Exposition der Nutzer erhöht. Eine weitere Quelle möglicher Schadstoffemissionen sind sogenannte Filamentextruder. Diese Geräte ermöglichen es Anwendern, das Filament selbst aus Kunststoffgranulat zu erzeugen. Die EPA hat auch die Emissionen solcher Extruder untersucht und festgestellt, dass die freigesetzten ultrafeinen Partikel in ähnlicher Größenordnung liegen wie bei herkömmlichen 3D-Druckern. Zudem nimmt die Vielfalt am Markt erhältlicher Spezialfilamente mit Zusätzen, beispielsweise Metallpartikeln oder flammhemmenden Mitteln, zu.
Diese Additive können nicht nur technische Eigenschaften verbessern, sondern gleichzeitig zusätzliche gesundheitliche Risiken bergen, da sie möglicherweise toxische Stoffe freisetzen. Von besonderer Relevanz ist die Exposition von Kindern und Jugendlichen. 3D-Drucker werden zunehmend in Schulen und Bildungseinrichtungen eingesetzt, wo die Nutzer oft noch nicht über die potenziellen Risiken aufgeklärt sind. Kinder gelten epidemiologisch als besonders schutzbedürftig, weil ihre Atemwege noch in Entwicklung sind und Schadstoffe sich langfristiger auf ihre Gesundheit auswirken können. Die meisten Gesundheitsstudien zu 3D-Druck-Emissionen beziehen sich bislang allerdings ausschließlich auf Erwachsene, sodass der spezielle Einfluss auf Kinder noch nicht umfassend erforscht ist.
EPA-Wissenschaftler nutzten das Multiple Path Particle Dosimetry Model (MPPD v3.04), um vorherzusagen, wie sich vorkommende ultrafeine Partikel in unterschiedlichen Altersgruppen und Atemwegen ablagern. Die Modellierung ergab, dass Jugendliche im Alter von neun bis achtzehn Jahren die höchste Masse an Partikeln in den Lungen einlagern. Das bedeutet ein erhöhtes Risiko für langfristige gesundheitliche Beeinträchtigungen, gerade wenn 3D-Drucker in schlecht belüfteten Klassenräumen oder Bibliotheken betrieben werden. Um den Gefahren entgegenzuwirken, empfiehlt die Nationale Institution für Arbeitsschutz und Gesundheit (NIOSH) Anwendern verbindliche Schutzmaßnahmen.
Dazu gehören der Einsatz von emissionsarmen Filamenten, das Verwenden von druckerumschließenden Schutzvorrichtungen sowie eine ausreichende Belüftung des Arbeitsraums. Auch sollte die Verweildauer nah am laufenden Drucker möglichst reduziert werden, um die Einatmung schädlicher Stoffe zu minimieren. Begleitend zu den technischen Maßnahmen ist eine gezielte Aufklärung der Anwender essenziell. Viele Nutzer sind sich der Gesundheitsrisiken nicht bewusst oder unterschätzen die Auswirkungen. Öffentliche Informationsangebote oder Workshops können dabei helfen, den sicheren Umgang mit 3D-Druck zu fördern.
Besonders für den Bildungssektor sind angepasste Leitlinien und Empfehlungen wichtig, da hier eine breite Altersspanne und unterschiedliche Nutzungsintensitäten bestehen. Insgesamt zeigt die Forschung der EPA, dass der 3D-Druck trotz seines technologischen Fortschritts nicht frei von Gesundheitsrisiken ist. Die Emissionen ultrafeiner Partikel und flüchtiger organischer Verbindungen stellen eine Herausforderung dar, die eine verantwortungsvolle Nutzung und weitere Studien erfordert. Insbesondere die potenziellen Langzeitfolgen bei Kindern und Jugendlichen sollten stärker erforscht werden, da diese Gruppe bisher zu wenig Beachtung fand. Neben der Gefahr für die menschliche Gesundheit wird auch die Umwelt durch die ausgesandten Stoffe belastet.
Flüchtige organische Verbindungen können zur Luftverschmutzung beitragen und damit indirekt ebenfalls gesundheitliche Beeinträchtigungen verursachen. Die Forschung entwickelt sich kontinuierlich weiter und liefert wichtige Erkenntnisse, um die Sicherheit von 3D-Druckern und Materialien zu verbessern. Letztlich verlangt die ausgefeilte Technologie der additiven Fertigung ein Umdenken hinsichtlich Sicherheitsstandards und Nutzerverhalten. Fortschritte in der Materialforschung, etwa durch die Verwendung emissionsarmer oder vollständig ungiftiger Filamente, könnten künftig zu einer deutlichen Senkung der gesundheitlichen Risiken führen. Ebenso könnten innovative Entlüftungssysteme und intelligente Sensoren zur Überwachung von Schadstoffkonzentrationen in Innenräumen den Schutz für Anwender optimieren.