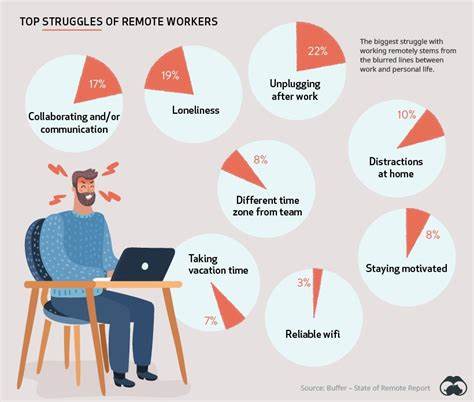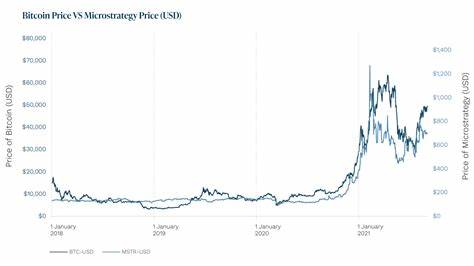Im digitalen Zeitalter verändert sich die Art und Weise, wie wir Software entwickeln und Produkte prototypisieren, rasant. Ein besonders spannender Trend dabei ist das sogenannte Vibe Coding – ein Ansatz, bei dem Entwickler mithilfe von KI-gestützten Tools in kurzer Zeit funktionale Softwarelösungen erstellen. Beim kürzlich veranstalteten Hackathon in Atlanta, bei dem ich selbst teilgenommen habe, war Vibe Coding nicht nur präsent, sondern bestimmend. Mit eben dieser Methode konnte ich den dritten Platz erreichen und einen Gewinn von 500 US-Dollar erzielen. Doch was bedeutet mein Erfolg für die Zukunft von Hackathons und die Produktentwicklung insgesamt? Diese Frage möchte ich mit meinem Erfahrungsbericht beantworten und die Dynamik hinter Vibe Coding näher beleuchten.
Vibe Coding ist ein Begriff, den ich persönlich nicht besonders mag, und ich stehe damit nicht allein. Dennoch gibt es kaum eine bessere Beschreibung für das, was diese neue Art des Programmierens auszeichnet: schnelles, experimentelles und stark KI-unterstütztes Prototyping. Viele Entwickler finden es spannend, neue Ideen schnell zu skizzieren und erste funktionale Prototypen zu erstellen, ohne dabei lange mit komplexem Code zu kämpfen. Besonders Tools wie Cursor, Lovable oder Bolt ermöglichen es, fast spielerisch Anwendungen in wenigen Stunden zu bauen – ganz so, wie ich es beim Hackathon erlebt habe. Während des Events, das im Rahmen der Music Biz Konferenz stattfand, stellte ich mir die Frage, ob und wie Vibe Coding die Art von Hackathons verändern wird, die bislang stark auf klassische Programmierfähigkeiten setzen.
Mein Ansatz war dabei, eine Produktidee umzusetzen, die Musikern moderne und zugleich nützliche Tools bündelt. Die Vision dahinter war simpel: Musiker in abgelegenen Regionen oder mit begrenzten Ressourcen sollen Zugriff auf wertvolles Wissen und Werkzeuge bekommen, die ihnen sonst verwehrt bleiben. Aus diesem Grund entschied ich mich für die Entwicklung eines Web-Tools namens „Field Notes“, das drei Kernfunktionen bieten sollte – einen Musik-Wissenschatbot, einen Stem Separator und ein Musik-Tagging-Tool. Die Umsetzung begann mit der Ideensammlung, die ich mit Hilfe von ChatGPT strukturierte. In den ersten Stunden skizzierte ich eine Produktanforderung und ließ die KI technische Details recherchieren und spezifizieren.
Die Vorteile hierbei lagen klar auf der Hand: Anstatt Stunden mit der formalen Ausarbeitung von Spezifikationen zu verbringen, konnte ich einen groben Rahmen schaffen, den die KI im nächsten Schritt ausarbeitete. Allerdings zeigte sich auch schnell das klassische Problem des Vibe Codings – die KI verstand nicht immer alle Anforderungen auf Anhieb und gerade komplexere Spezifikationen führten zu Verzögerungen. Der eigentliche Entwicklungsprozess erfolgte in Cursor, einem leistungsfähigen AI-gestützten Coding-Tool. Mein Workflow gründete sich darauf, jede neue Funktion, jeden Bugfix und jede Designänderung in einem eigenen Chat mit einer KI-Agentin oder einem Agenten zu bearbeiten. Diese klare Trennung von Aufgaben erleichterte es, den Überblick zu behalten und Kontextverluste zu vermeiden.
Ein spannendes Detail war, dass verschiedene KI-Modelle zum Einsatz kamen – von Anthropic's Claude über Google Gemini bis zu OpenAI's GPT-4.1. Während Claude 3.5 Sonnet meist als Hauptmodell fungierte, griff ich immer wieder auf die anderen Modelle zurück, wenn es um besonders komplexe oder festgefahrene Problemstellungen ging. Besondere Aufmerksamkeit erhielt die Integration von APIs, die oftmals von Sponsoren des Hackathons kostenfrei bereitgestellt wurden.
Die Nutzung externer Schnittstellen erwies sich als entscheidender Faktor, um meinen Prototypen schnell mit echten Musikdaten und Funktionen zu versehen. So wurde der Wissenschatbot mit Muserk verbunden, der detaillierte Informationen zu Streaming-Zahlen und Musikanalysen lieferte. Für die Zerlegung von Songaufnahmen in einzelne Stems kam AudioShake zum Einsatz, während Music.ai die Analyse und Verschlagwortung von Musikstücken übernahm. Dieser API-Mix ermöglichte es, das Toolkit nicht nur theoretisch sondern auch praktisch für Musiker wertvoll zu gestalten.
Die letzten Stunden vor der Deadline widmete ich kleinen Verbesserungen, Bugfixes und dem Feinschliff der Nutzeroberfläche. Das Nutzererlebnis war mir dabei besonders wichtig. So musste das Hochladen und Verarbeiten von Musikdateien flüssig und intuitiv funktionieren, um auch technisch weniger versierte Anwender nicht zu überfordern. Besonders stolz war ich auf ein kleines Feature namens „The Kitchen Sync“, das als humorvolle Anspielung auf „Sync Licensing“ gedacht war. Dabei wurden automatisch Tags aus Songs von der KI genutzt, um skurrile Lizenz-Vorschläge zu generieren – ein witziges Detail, das bei der Präsentation gut ankam.
Neben meinem Projekt gab es viele inspirierende andere Anwendungen, die ebenfalls stark auf KI-Coding setzten. Einige Teilnehmer entwickelten Dashboards zur Analyse von Musikproben, Tools für das Remixen von Songs oder komplexe Systeme zur Lyric-Analyse. Auffällig war, dass fast alle Teilnehmer intensiv KI-Unterstützung nutzten, was die Nähe von Vibe Coding zur Praxis zeigte. Aus meiner Sicht markiert dieses Ereignis einen Wendepunkt für Hackathons. Traditionelle Entwickler sind oft skeptisch bis ablehnend gegenüber KI-Code, weil er oft weniger sauber, manchmal unübersichtlich und schwer nachvollziehbar ist.
Dennoch bietet Vibe Coding eine niedrigschwellige Möglichkeit, schnell Prototypen zu erstellen und Ideen sichtbar zu machen. Daher rechne ich damit, dass sich die Hackathon-Welt spalten wird. Es werden einerseits Veranstaltungen entstehen, die KI-Coding als festen Bestandteil akzeptieren, bei denen Vielfalt, Schnelligkeit und die Präsentation von Produkten im Vordergrund stehen. Andererseits dürfte es bald vermehrt „AI-freie Hackathons“ geben, in denen bewährte Coding-Standards und tiefes technisches Verständnis gefordert werden – um weiterhin qualitativ hochwertige Software von Grund auf zu bauen. Mein Fazit aus diesem Hackathon ist, dass Vibe Coding ein Werkzeug mit großem Potenzial ist, das gerade Kreativen und Quereinsteigern neue Möglichkeiten eröffnet.
Die Geschwindigkeit, mit der man zu ersten Ergebnissen kommt, ist bahnbrechend und kann die Innovationszyklen deutlich beschleunigen. Für Unternehmen und Entwickler öffnet sich damit eine neue Dimension, Produkte zu testen und neue Marktchancen auszuloten. Die Musikbranche zeigt sich in diesem Kontext ebenfalls aufgeschlossen. Die Verbindung von Musik und Technologie ist längst kein Nischenthema mehr, sondern gewinnt immer mehr an Bedeutung. Plattformen, die Musikschaffenden den Zugang zu smarten Tools ermöglichen, schaffen nicht nur Mehrwert für die Nutzer, sondern fördern auch kreative Experimente, die sonst vielleicht nicht zustande kämen.
Insgesamt ist mein Gewinn von 500 Dollar mehr als nur ein finanzieller Anreiz. Er steht stellvertretend für den Wandel, der durch Künstliche Intelligenz und innovative Arbeitsweisen in der Softwareentwicklung möglich wird. Der nächste Hackathon wird mit Sicherheit noch aufregender, da sich die Methoden und Erwartungen auf allen Seiten weiterentwickeln. Wer heute schon mit Vibe Coding experimentiert, ist bestens vorbereitet, um morgen von den Chancen zu profitieren, die die Kombination aus Mensch und Maschine bieten wird.