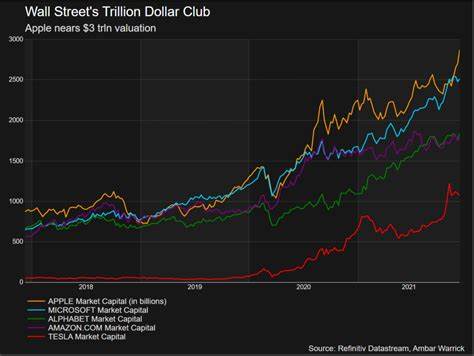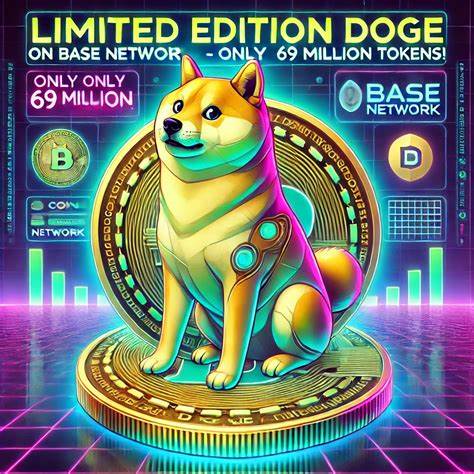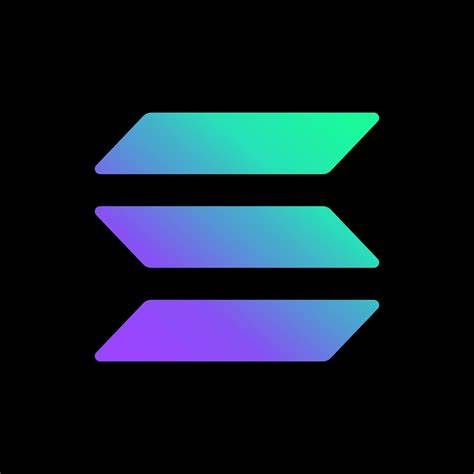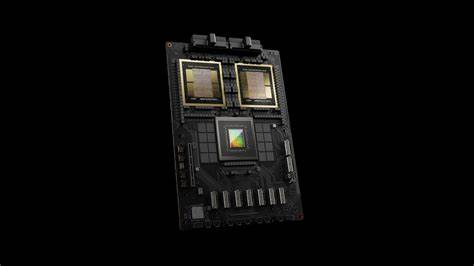Inmitten der sengenden Sommerhitze wird die griechische Hauptstadt Athen derzeit vor neue Herausforderungen gestellt. Die Stadt, geprägt von dicht bebauten Vierteln und ausgedehnten Betonflächen, kämpft seit Jahren mit steigenden Temperaturen, die durch den Klimawandel und städtische Hitzeinseln verstärkt werden. Das Pflanzen von Bäumen, als natürlicher Kühler des urbanen Raums, kommt für Athen jedoch erst jetzt in Gang – viel zu spät, wie Experten betonen. Jahrzehntelange Versäumnisse bei der Stadtbegrünung und der Umgestaltung urbaner Räume lassen die Einwohner der Millionenmetropole jetzt die Folgen spüren. Seit Anfang 2025 bemüht sich die neue Stadtverwaltung unter Bürgermeister Haris Doukas, dem hitzegeplagten Athen mit der Pflanzung von 5000 Bäumen pro Jahr entgegenzuwirken.
Die Initiative, die erste ihrer Art in der Geschichte Athens, versucht mit sogenannten „Mikro-Wäldern“ erste grüne Oasen in dicht besiedelten Stadtteilen wie Kypseli zu erschaffen. Eine Pilotzone mit zahlreichen jungen Setzlingen auf den Hügeln nahe des Alepotrypa-Parks markiert den Anfang. Doch die winzigen Bäumchen benötigen Jahrzehnte, bis sie ausgereift genug sind, um einen merklichen kühlenden Effekt zu erzielen. Kritiker wie die Stadtplanerin Katerina Christoforaki sprechen von „zu wenig, zu spät“. Ihrer Ansicht nach sind die Maßnahmen unzureichend, um die bestehende Hitzeproblematik spürbar zu lindern.
Besonders problematisch sieht sie die Infrastruktur der Stadt, die sich seit Jahrzehnten kaum verändert hat. Die meisten Gebäude und Straßen Athens bestehen aus Materialien, die vor über vierzig Jahren verbaut wurden und die Hitze im Sommer speichern, anstatt sie abzuweisen oder durch gute Isolierungen zu mildern. Die daraus resultierenden extremen Temperaturen belasten die Lebensqualität der Bürger erheblich. Die Dringlichkeit der Lage wird durch die steigende Zahl von Hitzewellen unterstrichen, die in den letzten Jahren neue Rekordwerte erreicht haben. So wurde im Sommer 2023 ein neuer Temperaturhöchstwert seit Beginn der offiziellen Wetteraufzeichnungen im Jahr 1863 gemessen.
Anhaltende Hitzeperioden mit Temperaturen stets über 40 Grad Celsius haben den Alltag der Einwohner drastisch verändert. Die natürliche Kühlung durch die Nähe zum Meer wird zudem durch den Bau von Hochhäusern an der Küste noch weiter behindert. Athens geografische Lage, umgeben von Bergen, führt dazu, dass die Stadt in einem sogenannten „kochenden Kessel“ gefangen ist. Dieser Effekt verstärkt die Hitze, da kaum Luftzirkulation möglich ist, die die Temperaturen abbauen könnte. Die geringe Menge an städtischem Grün, mit weniger als einem Quadratmeter grüner Fläche pro Einwohner, steht in starkem Kontrast zu den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation, die neun Quadratmeter empfiehlt.
Ein weiteres Problem ist der Verlust von 60 Prozent der umliegenden Wälder durch verheerende Waldbrände in den letzten Jahren. Diese intakten Wälder hätten früher nicht nur als Naherholungsgebiete gedient, sondern auch zur Kühlung der Stadt beigetragen und die Luftqualität verbessert. Die Folgen der Brände erhöhen die klimatischen Belastungen zusätzlich, da wichtige natürliche Ressourcen verschwunden sind. Dazu kommt, dass in der Zeit vor den Olympischen Spielen 2004 zwar intensiv in Infrastruktur wie Stadien und Verkehr investiert wurde, die Begrünung der Stadt jedoch stark vernachlässigt wurde. Die Prioritäten lagen auf kurz- bis mittelfristigen Effekten für den Tourismus und die moderne Erscheinung Athens, statt auf nachhaltigen ökologischen Maßnahmen.
Die Definanzierung urbaner Planungsbehörden infolge der langen Wirtschaftskrise Griechenlands führte weiterhin dazu, dass umweltfreundliche Projekte nicht ausreichend umgesetzt wurden. Die Stadtverwaltung unter Nikos Chrysogelos, dem amtierenden Stellvertreter für Klimaschutz und einem erfahrenen Umweltaktivisten, versucht jetzt, diese Versäumnisse auszugleichen. Klimakarten, die Temperaturverteilungen in Stadtteilen darstellen, gehören ebenso zu seiner Strategie wie die Installation von Sensorsystemen, die Hitzebelastungen in Echtzeit messen. Dies soll die Planung zielgerichteter Notfallmaßnahmen auf Hitzewellen verbessern und künftig Leben schützen. Da die Stadt jedoch erst jetzt beginnt, das Problem ernsthaft anzugehen, sind umfangreiche Maßnahmen notwendig, um der Klimakrise langfristig zu begegnen.
Für Experten ist klar, dass einzelne Mikroparks und kleine Bepflanzungen nicht ausreichen. Es braucht ambitionierte Schritte wie den radikalen Abbruch und die Neuplanung ganzer Stadtviertel, um ausreichend breite „grüne Korridore“ zu schaffen, die tatsächlich Kühlung bringen könnten. Zudem ist eine Kultur der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Stadtplanern, Bürgern und politischen Akteuren gefragt. Ohne gemeinsame Anstrengungen und politischem Willen wird das grüne Potenzial der Stadt nicht ausgeschöpft werden können. Die Vision von Bürgermeister Doukas ist daher, bis 2028 insgesamt 25.
000 neue Bäume zu pflanzen, was den Sommertemperaturen des Stadtgebiets um geschätzte drei bis fünf Grad Celsius entgegenwirken soll. Parallel investiert die Stadt in energieeffiziente Sanierungen von Verwaltungseinrichtungen und fördert emissionsarme Mobilitätsformen. Damit strebt Athen an, bis 2030 klimaneutral zu werden. Die Finanzierung dieser ehrgeizigen Pläne setzt auf europäische Fonds, staatliche Zuschüsse und private Investitionen, die insgesamt mehrere Milliarden Euro umfassen werden. Allerdings bemerken viele Einwohner, dass der Wandel bislang kaum spürbar ist.
Sie bemängeln, dass die städtischen Freiflächen zu klein sind und es an frischer Luft durch Bäume fehlt. Längst haben sich viele darauf eingestellt, ihre Aktivitäten auf die frühen Morgen- und späten Abendstunden zu verlegen, um der brütenden Hitze während des Tages zu entkommen. Die anhaltenden Klimaveränderungen lassen wenig Hoffnung auf kurzfristige Besserung zu. Neben der Herausforderung, die urbane Hitze abzufedern, bringt die Begrünung zahlreiche weitere Vorteile mit sich. Sie verbessert die Luftqualität, erhöht die Biodiversität in der Stadt und schafft lebenswerte Erholungsräume.
Für eine Metropole wie Athen, die sich den wachsenden Herausforderungen des Klimawandels stellen muss, sind diese Maßnahmen unverzichtbar, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung zu sichern. Die Entwicklung Athens vom heißen, betonlastigen Stadtzentrum hin zu einer grüneren, klimabewussteren Metropole wird in den kommenden Jahren entscheidend vom politischen Willen, innovativen Konzepten und dem Engagement der Bevölkerung abhängen. Dabei könnten Vorbildprojekte wie der Mikro-Wald in Alepotrypa als Piloten dienen, um das Bewusstsein zu schärfen und den Weg für größere, zusammenhängende Grünflächen zu ebnen. Die Zeit drängt, denn während die Bäume wachsen und ihre Wirkung entfalten, steigt die Temperatur in der Stadt weiter. Die bisherigen Versäumnisse mahnen Europas zweitbevölkerungsreichste Stadt nach Paris eindringlich, der Klimakrise keine weitere Bühne zu bieten, sondern aktiv und entschlossen gegenzusteuern.
Ein grünes Athen könnte nicht nur kühlere Sommer bringen, sondern auch ein besseres Lebensgefühl für Millionen Menschen schaffen – eine Herausforderung, die endlich ernst genommen werden muss.