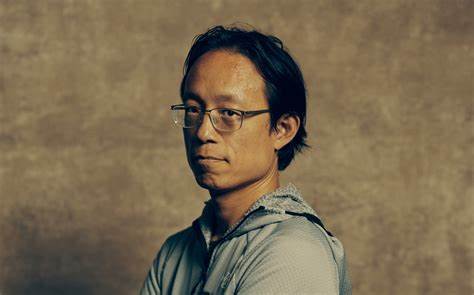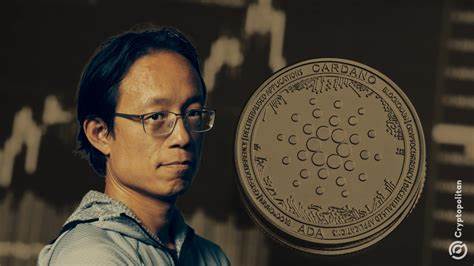Die Geschichte von Erlang bei Ericsson AB ist eine außergewöhnliche Erzählung über Innovation, technologische Durchbrüche und unternehmerische Fehlentscheidungen. Erlang war eine Programmiersprache, die bei Ericsson entwickelt wurde und schnell als bahnbrechend galt – so effizient und disruptiv, dass sie letztlich intern verboten wurde. Aller Anfang ist schwer, doch diese Geschichte beginnt im Jahr 1982, als der schwedische Telekommunikationsgigant Ericsson einen neuen Weg in der Softwareentwicklung suchte, um seine Telefonanlagen zu verbessern und zukunftsfähig zu gestalten. Zu jener Zeit experimentierte Ericsson mit mehr als 20 Programmiersprachen, darunter bekannte Namen wie Lisp, Prolog und Parlog. Die Anforderungen an die neue Sprache waren präzise: Sie sollte hochentwickelt und symbolisch sein, was bedeutet, dass sie leicht lesbar und nachvollziehbar sein musste.
Gleichzeitig sollte sie über grundlegende Funktionen für Nebenläufigkeit und Fehlerwiederherstellung verfügen. Das Ausführungsmodell durfte keine Rücksprünge enthalten, um Klarheit im Ablauf zu gewährleisten. Diese Parameter zeigten deutlich, dass Ericsson nicht nur eine effiziente Sprache wollte, sondern eine, die speziell für hochkomplexe und fehlerresistente Telekommunikationssysteme geeignet war. Der Auswahlprozess zog sich über mehrere Jahre hin, und trotz intensiver Suche fand das Entwicklungsteam keine Sprache, die alle Kriterien erfüllte. Im Ergebnis entschieden sich die Ingenieure 1985 bis 1986 dazu, eine eigene Programmiersprache zu entwickeln, die nach ihren Anforderungen maßgeschneidert war.
Aus dieser Vision entstand Erlang. Die ersten Entwicklungsversuche begannen 1987, und bis 1989 wurde ein Teil des Ericsson MD-110-Systems mit Erlang nachprogrammiert. Das Ergebnis war beeindruckend: Im Vergleich zu traditionellen Methoden verbesserte Erlang die Entwicklerproduktivität um das Achtfache – eine noch heute bemerkenswerte Leistung. Selbst wenn konservativere Schätzungen verwendet wurden, lag die Produktivitätssteigerung mindestens dreimal höher. Doch die Euphorie hatte einen Dämpfer.
Trotz der enormen Produktivitätsgewinne war Erlang selbst zu langsam. Die Sprache musste rund vierzigmal schneller werden, um praktisch einsetzbar zu sein. Das kleine Entwicklungsteam aus nur zwei Menschen gab jedoch nicht auf. Im Jahr 1989 wurde Erlang auf der SETSS-Konferenz erstmals öffentlich präsentiert, wobei die Entwickler ihren Fokus darauf legten, eine Sprache zu schaffen, deren Modell auf Fehlerfreiheit ausgelegt ist und die unter Ausfallbedingungen robust bleibt. Diese Vision stieß zunächst weltweit auf Skepsis, doch die Pioniere bei Ericsson waren fest überzeugt, dass ihr Ansatz wegweisend sein würde.
In den folgenden sechs Jahren erfuhr Erlang kontinuierliche Verbesserungen, wobei die Sprache immer schneller und funktionsreicher wurde. Das Team wuchs auf hunderte Entwickler an und begann nicht nur an technischen Lösungen zu arbeiten, sondern auch Partnerschaften zu schließen und die Sprache extern zu vermarkten. Ein wichtiger Meilenstein war die Lieferung der ersten Erlang-Implementierung an Bellcore im Jahr 1990, ein erstes Zeichen für die wachsende Anerkennung außerhalb Schwedens. Der Wendepunkt kam jedoch Ende 1995, als das große Projekt AXE-N bei Ellemtel scheiterte. Dieses Vorhaben, eine neue Hardware- und Softwarelösung für Netzwerke auf Basis von C++ zu entwickeln, war spektakulär gescheitert und verursachte bei den Beteiligten massive Verzweiflung.
Dieses Desaster öffnete Erlang die Tür, um die gescheiterte Softwarelösung zu ersetzen. Das Projekt erhielt unter dem neuen Namen AXD eine zweite Chance, wobei die Hardware von AXE-N weiterverwendet wurde, aber die Software komplett in Erlang neu geschrieben wurde. Das AXD-Projekt entwickelte sich zur größten Anwendung von Erlang überhaupt und beschäftigte mehr als 60 Entwickler, die überwiegend aus der Industrie kamen und keine Vorkenntnisse in funktionaler oder nebenläufiger Programmierung hatten. Dennoch lernte das Team Erlang schnell und setzte es effizient um. Mit über 1,13 Millionen Zeilen Code beim Start und über 2,6 Millionen Zeilen im weiteren Lebenszyklus bewies das Projekt beeindruckende Skalierbarkeit.
Zudem konnte das System eine Zuverlässigkeit von neun Neunen (99,9999999%) über 20 Jahre im Live-Betrieb vorweisen – ein Grad an Stabilität, den kaum eine andere Lösung erreichte. Auch die Produktivität blieb bemerkenswert, mit Schätzungen, die eine vierfache Effizienz gegenüber herkömmlichen Ansätzen belegten. Jede Zeile Erlang-Code konnte demnach etwa fünf Zeilen Standard-C ersetzen, was die Komplexität und den Arbeitsaufwand drastisch reduzierte. Doch trotz dieses Erfolgs war die Stimmung bei Ericsson ambivalent. Noch vor der offiziellen Markteinführung des AXD im Jahr 1998 verbot Ericsson Radio Systems, eine Tochtergesellschaft des Konzerns, die Nutzung von Erlang intern.
Begründet wurde das Verbot mit der Verwendung einer proprietären Sprache, aber viele Beobachter vermuten tiefere und weniger offensichtliche Gründe, die mit internen Unternehmenspolitiken und Angst vor disruptiven Neuerungen zu tun hatten. Das Verbot bedeutete das Ende von Erlang bei Ericsson selbst und führte zu einer unausweichlichen Konsequenz: Der Ursprungscode wurde unter Open-Source-Lizenz freigegeben. Maßgeblich war hier das Engagement von Jane Walerud, die mit harter Überzeugungsarbeit das Management umstimmte. Die Veröffentlichung im Dezember 1998 öffnete Erlang für die Welt und ermöglichte, dass es außerhalb des Konzerns weiterlebte und sich entfalten konnte. Mit der Freigabe verließen viele der ursprünglichen Entwickler das Unternehmen, gründeten Bluetail AB, ein Start-up mit Jane Walerud als CEO, das sich auf Erlang-Produkte spezialisierte.
Der Erfolg schien greifbar, und 2000 wurde Bluetail von Nortel Networks für 152 Millionen Dollar übernommen. Doch unglücklicherweise fiel die Übernahme in die Zeit des geplatzen IT-Booms, was zu Entlassungen und Finanzproblemen führte, die auch das Erlang-Ökosystem trafen. Trotz allem hat die Geschichte von Erlang bei Ericsson mehrere Lehren parat. Sie zeigt eindrucksvoll, wie bahnbrechende Innovationen von etablierten Unternehmen abgelehnt und dadurch nahezu zum Scheitern verurteilt werden können. Zugleich unterstreicht sie die Bedeutung von offenem Quellcode zur Verbreitung und Weiterentwicklung von Technologien.
Erlang hat sich letztlich außerhalb von Ericsson durchgesetzt und prägt bis heute die Entwicklung von Systemen mit hohen Anforderungen an Parallelität und Zuverlässigkeit. Von der Verzweiflung über das Scheitern des AXE-N-Projekts hin zur revolutionären Umsetzung mit Erlang entwickelte sich innerhalb weniger Jahre eine der fortschrittlichsten Softwarelösungen der Telekommunikationsgeschichte. Es war ein Erfolg, der jedoch von internen Widerständen und strategischen Fehlentscheidungen überschattet wurde. Die Geschichte von Erlang dient nicht nur als Lehrstück für Softwareentwicklung, sondern auch als Mahnung an Unternehmen, innovative Technologien nicht aus Angst vor Veränderung oder mangelndem Verständnis zu verdrängen. Die einzigartige Kombination aus funktionaler Programmierung, Nebenläufigkeit und Fehlertoleranz war wegweisend und zeigt, dass technische Exzellenz nicht immer automatisch zum unternehmerischen Erfolg führt.
Heute hat Erlang eine treue Gemeinschaft von Entwicklern auf der ganzen Welt und ist Grundlage zahlreicher Systeme, die hohe Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit erfordern. Die Ursprünge bei Ericsson bleiben ein faszinierendes Kapitel in der Geschichte der Softwareentwicklung – ein Beleg dafür, wie eine scheinbar verbannte Programmiersprache die IT-Welt tiefgreifend beeinflussen kann.