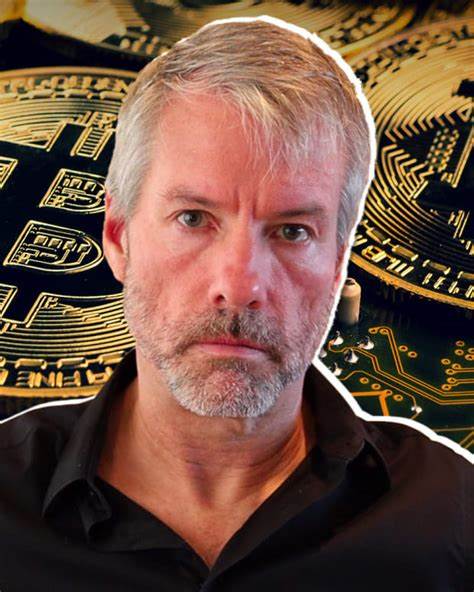In der dynamischen Welt der künstlichen Intelligenz erleben traditionelle Vorstellungen von Arbeitszeiten einen grundlegenden Wandel. Besonders in der Startup-Szene ist die klassische 5-Tage-Arbeitswoche schon lange nicht mehr die Norm. Schon seit Jahren wird in Technologieunternehmen, vor allem in den USA, von der sogenannten "Hustle Culture" gesprochen – einer Arbeitsphilosophie, die extreme Arbeitsbelastung und unermüdlichen Einsatz glorifiziert. Doch in der aktuellen KI-Branche gehen einige Startups noch einen Schritt weiter. Für viele Firmen reicht eine siebentägige Arbeitswoche nicht aus – sei es in Form von sechs oder sogar sieben Tagen mit intensiven Arbeitseinsätzen.
Diese Entwicklung wirft Fragen zu Produktivität, Arbeitsrecht, Arbeitskultur und langfristiger Nachhaltigkeit auf.Einer der Vorreiter dieser Bewegung ist Arrowster, ein junges KI-Unternehmen, das sich auf Bildungsanwendungen spezialisiert hat und Studierenden hilft, Auslandsstudienprogramme zu finden. Ihr CEO Kenneth Chong beschreibt die Unternehmensphilosophie unverblümt: Wer sich für die Arbeit in seinem Startup entscheidet, wählt auch das Leben eines Leistungssportlers. Dabei geht es nicht nur um die reine Anzahl der Arbeitsstunden, sondern um ein intensives Engagement, das über klassische Arbeitszeiten hinausgeht. Für ihn sind die traditionellen Konzepte der Arbeitswoche mit fünf Arbeitstagen und zwei freien Tagen antiquiert und nicht mehr zeitgemäß angesichts der heutigen Anforderungen.
Dieses Mindset ist nicht auf Arrowster beschränkt. Andere Startups mit Y Combinator-Unterstützung wie Corgi, ein Unternehmen aus dem Versicherungsbereich, arbeiten ebenfalls konsequent sieben Tage die Woche in ihren Büros in San Francisco. Dabei geht es weniger um eine starre Vorgabe, sondern eher um eine Kultur, die durch eine gemeinsame Leidenschaft und den Wunsch, Grenzen zu überschreiten, geprägt ist. Die Gründer betonen, dass eine solche Intensität essenziell ist, um in einem Umfeld zu bestehen, in dem Innovationsgeschwindigkeit und Marktdruck täglich neue Maßstäbe setzen.Neben den sieben Tagen gibt es Unternehmen, die eine sechstägige Arbeitswoche als neuen Standard akzeptieren.
Beispiele hierfür sind Latchbio im Biotechnologiebereich oder die KI-Firmen Autotab und Mercor, einem erfolgreichen Personaldienstleister mit Milliardenbewertung. Letzteres bietet sogar Anreize in Form von großzügigen Wohnzuschüssen, um Mitarbeiter nahe am Unternehmenssitz zu halten und die Produktivität so hoch wie möglich zu halten. CEO Brendan Foody von Mercor sieht die intensive Arbeitskultur als einen Wettbewerbsvorteil, der allerdings mit zunehmender Unternehmensgröße an Relevanz verlieren könnte.Nicht immer sind diese strikten Vorgaben zwingend. Einige Startups wie Decagon fördern eine eher freiwillige Teilhabe an der intensiven Arbeitskultur, die sich organisch entwickelt hat.
Mitarbeiter, die beispielsweise auch sonntags in das Büro kommen, schätzen besonders die Möglichkeit zur konzentrierten Zusammenarbeit ohne die üblichen Büro- oder Videokonferenzunterbrechungen. Diese Atmosphäre ermöglicht es Teams, schneller und kreativer zu arbeiten, was im rasanten KI-Sektor entscheidend sein kann.Die Hintergründe für diese extreme Arbeitskultur liegen im gnadenlosen Wettbewerb. KI-Startups buhlen nicht nur untereinander um Investitionen und Talente, sondern stehen auch etablierten Technologiekonzernen gegenüber, die massiv in KI investieren und mit ihren Ressourcen und Reichweiten junge Unternehmen schnell überholen können. Gleichzeitig sorgen globale KI-Schwergewichte wie OpenAI oder Anthropic für ständigen Innovationsdruck durch kontinuierliche Updates und neue Funktionen, die Startups bloß nachzuahmen kaum die nötige Zeit geben.
Der Berliner Mitbegründer des KI-Startups Greptile, Daksh Gupta, erlebt dieses Spannungsfeld hautnah. Seine drastische Warnung vor harten, seis bis sieben Tage andauernden Arbeitswochen führte nicht nur zu kritischen Reaktionen, sondern auch zu einem überraschend hohen Bewerbungsaufkommen. Der Konkurrenzkampf um Talente zwinge Gründer dazu, intensives Arbeiten als Standard zu etablieren, um am Markt bestehen zu können. Dabei ist die Situation keineswegs neu: In anderen Teilen der Welt gibt es ähnliche oder sogar härtere Arbeitszeiten. Das Modell „996“ in China, das von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends an sechs Tagen wöchentlich fordert, ist etwa bei Giganten wie Alibaba oder ByteDance weit verbreitet.
Auch in Südkorea und Griechenland gibt es gesetzlich oder kulturell verankerte Verlängerungen der Arbeitszeit in bestimmten Branchen.Trotz der Häufigkeit dieser Praktiken steht die Ausweitung der Arbeitswoche auf sechs oder sieben Tage auch in der amerikanischen Startup-Szene in einer langen Tradition von „Hustle“-Mentalität und extremen Arbeitszeiten. Unternehmer wie Elon Musk oder Travis Kalanick haben öffentlich die harte Arbeit als Grundsatz propagiert, die einen Wettbewerbsvorteil bringe. Dennoch wird zunehmend auch die Schattenseite dieser Kultur thematisiert: Burnout, Mitarbeiterfluktuation und die Frage, wie lange ein solches Arbeitspensum aufrechtzuerhalten ist, ohne die Gesundheit oder die Lebensqualität zu opfern.Juristisch betrachtet gibt es in den USA keine Obergrenzen der Anzahl von Arbeitstagen, solange Mitarbeiter als „exempt“ gelten und damit nicht unter geltende Überstundenregelungen fallen.
Besonders in Kalifornien, dem Hotspot vieler Tech-Startups, sind diese Kriterien meist erfüllt. Allerdings bestehen Bedenken hinsichtlich möglicher Diskriminierung älterer Kollegen oder Menschen mit familiären Verpflichtungen, die unter einer solchen Arbeitskultur leiden könnten. Experten betonen, dass Qualität der Arbeitszeit wichtiger sei als reine Quantität und dass Unternehmen langfristig auf nachhaltige und ausgewogene Arbeitsmodelle setzen sollten, um Effizienz und Mitarbeitermotivation zu sichern.Das führt zu einer scheinbaren Paradoxie: Während einerseits KI-Technologien häufig als Schlüssel zu mehr Produktivität und kürzeren Arbeitszeiten angepriesen werden, kennen viele Unternehmen in der Branche selbst nur eine Richtung: Mehr Arbeit, intensiver, länger. Einige Experten und Gründer schlagen jedoch vor, die Intensität der Arbeit in wechselnde Phasen intellektueller und körperlicher Regeneration zu unterteilen.
Statt den klassischen Wochenrhythmus zu nutzen, könnten kürzere Arbeitsblöcke mit geplanten Erholungsphasen, etwa kurzen Nickerchen oder entspannten Pausen, den Gesamtoutput steigern und Burnout vermeiden.Vor dem Hintergrund zeigt sich, dass AI-Startups sich in einem Rennen befinden, das jede traditionelle Arbeitsdefinition sprengt. Die nächste Lern- und Entwicklungsphase der Technologie erfordert hochengagierte Teams, die bereit sind, über konventionelle Grenzen hinweg zu arbeiten. Gleichzeitig ist die Branche gefordert, neue Wege zu finden, um langfristig Talent zu binden und produktiv zu bleiben – ohne dabei Gesundheit und Zufriedenheit der Mitarbeiter aufs Spiel zu setzen.So ungemütlich der Begriff „7-Tage-Arbeitswoche“ auch klingt, er beschreibt nur einen Aspekt eines tiefgreifenden Wandels in der Tech-Branche.
Die Verschiebung vom klassischen 40-Stunden-Job hin zu einer Flexibilisierung und Intensivierung der Arbeitszeitmodelle spiegelt die Rasantigkeit und Komplexität der heutigen Innovationen wider. Ob sich dieser Trend langfristig durchsetzen wird oder durch neue Konzepte und Technologien – eventuell auch unterstützt durch die KI selbst – abgelöst wird, bleibt spannend. Klar ist jedoch, dass Gründer, Investoren und Mitarbeiter gleichermaßen neue Vorstellungen von Arbeit, Leistung und Lebensqualität miteinander in Einklang bringen müssen, um die Zukunft der Innovation erfolgreich und nachhaltig zu gestalten.





![How to play 60kHz samples on an unmodified Commodore PET, poorly [video]](/images/009A0C46-1D60-4363-8D94-9C7C757B4B0C)