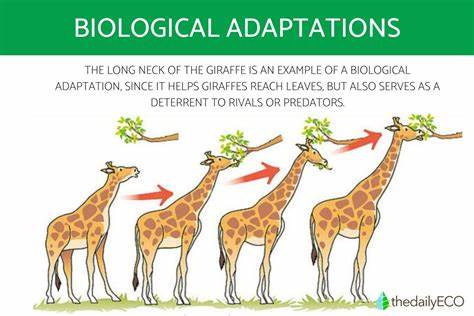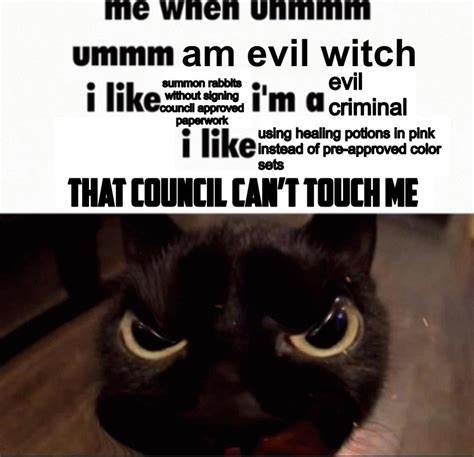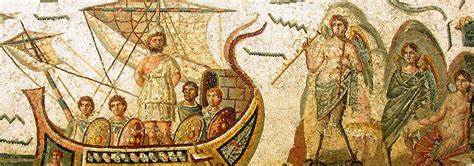In den letzten Jahren hat sich No-Code als eine revolutionäre Methode präsentiert, mit der Unternehmer, Startups und sogar etablierte Unternehmen ohne tiefgehende Programmierkenntnisse digitale Produkte entwickeln können sollen. Die Vorstellung, komplexe Anwendungen mit wenigen Klicks und einfachen Drag-and-Drop-Oberflächen zu bauen, versprach enorme Zeit- und Kosteneinsparungen sowie größere Zugänglichkeit für Nicht-Techniker. Doch der spektakuläre Fall von Builder.ai, einem der prominentesten Vertreter dieser Bewegung, hat viele Illusionen zerstört und wirft weitreichende Fragen für Gründer und Unternehmer auf. Builder.
ai startete mit großem Hype und beeindruckender Finanzierung. Mit rund 450 Millionen US-Dollar an Investitionen schien das Unternehmen auf dem besten Weg, die Art und Weise, wie Software entwickelt wird, grundlegend zu verändern. Das Konzept war einfach und verlockend: KI und Automatisierung sollten den kompletten Entwicklungsprozess übernehmen, von der Erstellung der Architektur über das Design bis zur Implementierung. Doch trotz der millionenschweren Förderung zeigte sich bald die harte Realität hinter dem Versprechen. Der Kern des Problems lag in der falschen Vorstellung, dass Softwareentwicklung einfach automatisierbar ist.
Hinter der glänzenden Fassade und den marketingwirksamen Begriffen versteckten sich in Wirklichkeit Tausende von Ingenieuren, die manuell an den Projekten arbeiteten. Die Technologie war nicht jener magische Code-Generator, der vollständige, einzigartige und komplexe Anwendungen eigenständig erschafft. Stattdessen wurde ein großer Teil der Arbeit durch klassische Programmierung und viel menschlichen Aufwand erledigt. Diese Diskrepanz führte zu enormen Kosten – Builder.ai verbrauchte innerhalb kürzester Zeit Unsummen.
Insgesamt beliefen sich die Ausgaben auf rund 40 Millionen US-Dollar pro Quartal, selbst nach erheblichen Einsparungen blieben es noch 21 Millionen Dollar pro Quartal Kosten. Zudem verschuldete sich das Unternehmen bei AWS mit fast 88 Millionen US-Dollar, nur um die bestehenden Anwendungen online zu halten. Diese Zahlen zeigen eindrücklich, wie teuer und aufwendig selbst eine angeblich automatisierte Softwareentwicklung war. Für Gründer und Startups entstehen aus diesem Szenario wichtige Lektionen. Zum einen wird deutlich, dass Software mehr ist als nur das reine Schreiben von Code.
Ein digitales Produkt verlangt Einfühlungsvermögen in Design, Nutzerfreundlichkeit, Datenstrukturen und kontinuierliche Weiterentwicklung. Es geht um die ständige Anpassung an Marktanforderungen und Nutzerverhalten, die keine starre Template-Lösung bieten kann. Jedes erfolgreiche Produkt ist ein lebendiges System, das sich mit seinen Anwendern weiterentwickelt. Die Gefahr von No-Code-Plattformen liegt genau darin, dass sie zwar schnellen Einstieg ermöglichen, aber oft auf uniforme und austauschbare Apps hinauslaufen. Will man ein Produkt mit Alleinstellungsmerkmal schaffen, wird es mit standardisierten Bausteinen schwierig.
Auch der Kontrollverlust spielt eine entscheidende Rolle: Wer auf eine externe Plattform baut, besitzt meist nicht den eigenen Code oder die volle Kontrolle über Daten und Hosting. Diese Abhängigkeit kann im Falle einer Insolvenz oder eines plötzlichen technischen Problems die Existenz des gesamten Startups bedrohen. Der aktuelle Zustand von Builder.ai wirft zudem Fragen zur Zukunft von Akquisitionen und Investitionen auf. Ein Unternehmen, das hauptsächlich auf No-Code-Konstrukten basiert, wird von potenziellen Käufern oft skeptisch betrachtet.
Denn die Frage ist, was genau gekauft wird, wenn das Produkt in Wirklichkeit nur eine angepasste Website oder eine einfache App ist, die ohne tiefere technische Substanz auskommt. Investoren bevorzugen langfristig tragfähige und skalierbare Modelle, die echten technologischen Wert besitzen. Diese Erkenntnisse gelten aber nicht nur für No-Code-Anbieter, sondern für die gesamte Branche der SaaS- und Plattformanbieter. Lock-in-Effekte sind weit verbreitet, von bekannten Baukastensystemen wie Wix und Shopify bis hin zu spezialisierten Softwarelösungen. Wer sich zu stark an einen Anbieter bindet, riskiert nicht nur den Verlust der Kontrolle, sondern auch erhebliche Kosten und komplizierte Migrationen in der Zukunft.
Dies ist ein Risiko, das viele Gründer unterschätzen, gerade wenn der Druck besteht, schnell ein Produkt auf den Markt zu bringen. Mit den Fortschritten im Bereich Künstliche Intelligenz und Code-Assistenten scheinen erneut neue Wunderwaffen verfügbar. Tatsächlich sind LLMs (Large Language Models) und deren Integration in Entwicklungswerkzeuge beeindruckend und können den Prozess erleichtern und beschleunigen. Aber diese Hilfsmittel ersetzen keine fundierte Produktentwicklung oder eine klare Vision. Sie sind Werkzeuge – mächtige Werkzeuge – doch ohne den richtigen Anwender, der den Zweck und die Struktur versteht, bleiben sie wenig mehr als generische Hilfsmittel, die wahllos verwendet werden.
Gerade Gründer sollten daher eine realistische Haltung zu No-Code und KI-gestützter Entwicklung einnehmen. Es geht nicht darum, die Technologie komplett abzulehnen, sondern sie als eine von vielen Optionen sinnvoll zu nutzen und dabei stets das größere Bild im Auge zu behalten. Softwareentwicklung erfordert Kreativität, technisches Know-how und eine sorgfältige Planung rund um das Nutzererlebnis, die Produktstrategie und Skalierbarkeit. Der Zusammenbruch von Builder.ai ist in gewisser Weise eine Warnung: Es gibt keine Abkürzungen zu großartigen digitalen Produkten, schon gar nicht durch rein automatisierte Prozesse.
Trotz aller Begeisterung für Automatisierung und vereinfachte Werkzeuge bleibt Softwareentwicklung eine komplexe Disziplin, die Zeit, Wissen und vor allem praktischen Einsatz braucht. Nicht zuletzt zeigt der Fall auch, wie wichtig Transparenz für Gründer ist. Finanzierungsrunden können verlockend sein, jedoch darf man sich nicht von glänzenden Versprechen blenden lassen. Die tatsächlichen Kosten und Herausforderungen hinter Plattformen sollten kritisch hinterfragt werden. Wer die Illusion von No-Code erkennt und sich auf echte Softwareentwicklung vorbereitet, hat bessere Chancen, langfristig erfolgreich zu sein.
Die Zukunft der Softwareentwicklung wird hybrider und vielseitiger sein. Kombinationen aus No-Code, Low-Code, klassischem Coding und KI-Werkzeugen werden gemeinsam genutzt, um Effizienz und Qualität zu steigern. Doch das Fundament bleibt: eine klare Produktvision, tatsächliche technische Kompetenz und die Fähigkeit, kontinuierlich auf Nutzerfeedback und Marktveränderungen zu reagieren. Egal, ob man als Gründer mit begrenztem Budget startet oder bereits investierte Ressourcen managt – die Lektion aus dem Fall Builder.ai lautet: No-Code ist eine wertvolle Ergänzung, aber kein Ersatz für echte Softwareentwicklung.
Wer diese Einsicht verinnerlicht, kann bessere Entscheidungen treffen, Risiken minimieren und letztlich Produkte schaffen, die nicht nur funktionieren, sondern auch Bestand haben.