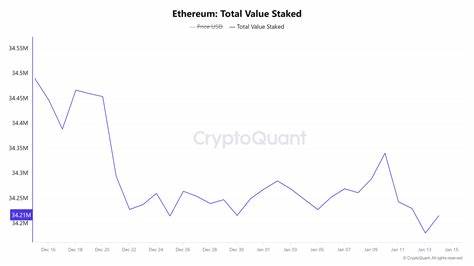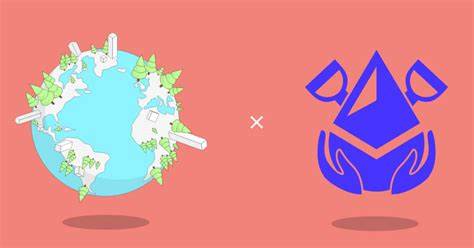In der Geschichte der Informatik nimmt Edsger W. Dijkstra eine herausragende Stellung ein. Seine 1972 gehaltene Rede „The Humble Programmer“ gilt als Meilenstein, der nicht nur die damaligen Herausforderungen des Programmierens beleuchtet, sondern auch richtungweisende Gedanken für die Zukunft formuliert. In einer Zeit, in der Computer gerade erst an Bedeutung gewannen und die meisten noch Großrechner mit begrenzten Ressourcen waren, zeigte Dijkstra mit unvergleichlicher Klarheit, was es bedeutet, ein Programmierer zu sein – nämlich ein sehr bescheidener, doch hochkompetenter Entscheider in einem komplexen System. Sein Vortrag gibt wertvolle Einblicke in die Ursprünge der Programmierung und öffnet zugleich den Blick auf die Herausforderungen, mit denen sich heutige Softwareentwickler konfrontiert sehen.
Dijkstra begann seine Karriere im Frühjahr 1952 in den Niederlanden und hatte die seltene Erfahrung, als einer der ersten Programmierer seines Landes tätig zu sein. Er schildert die damalige Zeit als geprägt von einer langsamen Entwicklung des Berufsbildes „Programmierer“. Damals wurde die Tätigkeit nicht als eigenständiger, respektabler Beruf anerkannt. Für viele war Programmieren keine intellektuelle Disziplin mit eigenem Wissensfundament, sondern eher eine Hilfstätigkeit an den großen Rechenmaschinen, die selbst das eigentliche Zentrum der Aufmerksamkeit darstellten. So wurde Dijkstra zeitweise nicht einmal als Programmierer anerkannt – selbst bei seiner Trauung ordneten die Behörden sein Berufsfeld formal der theoretischen Physik zu, seinem Studienfach, und nicht seiner eigentlichen Arbeit am Computer.
Die ersten Computer waren Unikate, experimentelle Apparate, die oft mehr technische Herausforderungen boten als rechenintensive Aufgaben. Ihre Zuverlässigkeit war begrenzt, und Programmierer mussten mit den kleinsten Ressourcen haushalten. Die Kunst lag häufig darin, durch clevere Tricks das Optimum aus dem begrenzten Speicher und der langsamen Geschwindigkeit herauszuholen. Aus dieser Erfahrung entstand das Bild, dass Programmieren vor allem ein Puzzle voller geschickter Kniffe sei. Dabei wurde nicht selten die Bedeutung eines systematischen und methodischen Ansatzes unterschätzt.
Fehlerbehebung (Debugging) erschien zeitaufwändig, war aber essenziell, da Materialien und Werkzeuge den hohen Anforderungen selten direkt gerecht wurden.Die Hoffnung lag unter anderem darin, dass mit leistungsstärkeren Maschinen das Programmieren einfacher werden würde – der Aufwand, Programme für sehr begrenzte Hardware zu optimieren, könne entfallen. Doch im Gegenteil, mit wachsender Rechnerkapazität stiegen auch die komplexen Anforderungen an Software exponentiell, was zur sogenannten Softwarekrise führte. Obwohl die Hardware verbesserte Leistung, Geschwindigkeit und Verlässlichkeit bot, blieben die Anwendungen komplex, umfangreich und fehleranfällig. Neue Probleme entstanden, unter anderem durch nicht-deterministisches Verhalten durch Interrupts oder mehrstufige Speicherhierarchien, die das Management von Speicher und Ressourcen erschwerten.
Dijkstra kritisierte unter anderem die Entwicklung der „dritten Computergeneration“, deren Design zwar ökonomisch und leistungsorientiert war, dabei aber häufig die Programmierbarkeit und Wartbarkeit beeinträchtigte. Er bezeichnete diese Entwicklung als mögliche Bremse für den Fortschritt der Informatik, da unüberlegte Designentscheidungen langfristig zu höherem Aufwand und geringerer Effizienz bei der Softwareentwicklung führten. Seine Forderung nach kritischer Überprüfung und Bewertung von Hardware-Entwürfen anhand strukturierter Kriterien war damals ebenso wie heute hochaktuell.Eine bedeutsame Erkenntnis aus seiner Rede ist die große Bedeutung der Werkzeuge, mit denen Programmierer arbeiten. Die Wahl der Programmiersprache, die Strukturierung von Programmen und die verwendeten Konstrukte haben maßgeblichen Einfluss darauf, wie ein Entwickler denken und Probleme angehen kann.
Dijkstra verweist auf die Grundprinzipien guter Sprachelemente, die den Geist des Programmierers fördern und nicht einschränken sollen. So erhob er die „geschlossen subroutine“ – eine heute als Subroutine oder Funktion bekannte Abstraktion – zu einem der wichtigsten Werkzeuge, die beständige Wiederverwendbarkeit und Modularität ermöglichen.Mit FORTRAN sah er eine Sprache, die damals sehr erfolgreich war, jedoch inzwischen an ihre Grenzen gestoßen ist. Ihre mangelnden konzeptionellen Hilfsmittel machten das Programmieren risikoreich und ineffizient – eine Erfahrung, von der viele heutige Entwickler profitieren, indem sie in fortschrittlichere Paradigmen und Sprachen wechseln. Dijkstra selbst war ein Verfechter von klaren und bescheidenen Programmierpraktiken, die den Intellekt schonen und Fehlerquellen reduzieren.
Die sehr komplexe Sprache PL/1 kritisierte er als eines der gefährlichen Beispiele für „sprachliche Tumore“, die Programmierer eher behindern als fördern.Ein weiterer wichtiger Akzent liegt auf der Bedeutung der Formalisierung und Disziplin. Programmieren sei keine Tätigkeit, bei der man sich auf Trial-and-Error verlassen könne. Dijkstra propagierte die enge Verbindung von Programm und formalen Korrektheitsbeweisen. Dies bedeutet, Programme so zu entwerfen, dass ihre einwandfreie Funktion mathematisch oder logisch überprüft werden kann.
Diese Haltung führt zwangsläufig zu einer hohen Programmqualität und minimiert teure Fehlerbehebungen im Nachhinein. Während das Testen zwar Fehler aufdecken kann, ist es nicht in der Lage, deren Abwesenheit zu beweisen. Dijkstra forderte, dass Programmierer Korrektheit und Programm von Anfang an Hand in Hand wachsen lassen.Zusammenhängend mit dieser Idee steht die Forderung nach Einschränkung auf „intellektuell beherrschbare“ Programme. Bei komplexen Systemen kann nämlich der Aufwand zum Verstehen mit der Länge des Codes überproportional wachsen, wenn nicht bestimmte Mustern und Abstraktionen genutzt werden.
Das Einführen von Hierarchien und klaren Schichten ist dabei zentral, um große Systeme zergliedern und kontrollieren zu können. Hier beschreibt Dijkstra eine der fundamentalen Maximen der Softwareentwicklung, die sich bis heute in allen großen Softwarearchitekturen manifestiert.Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Demut des Programmierers. Dijkstra appelliert an jeden Entwickler, seine eigenen Grenzen zu kennen und anpassungsfähig zu sein sowie den Einsatz von „cleveren Tricks“ zu vermeiden. Softwareentwicklung ist kein Wettbewerb, wer den geringsten Code schreibt oder die komplizierteste Konstruktion bastelt, sondern eine Disziplin, die auf Verständlichkeit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit baut.
Die „Humility“ des Programmierers bedeutet, stets am Wohl der Software und ihrer Nutzer orientiert zu sein und nicht am eigenen Ego.Dijkstra stellte drei Voraussetzungen für eine Revolution in der Programmierung vor, die noch heute von Bedeutung sind: Das gesellschaftliche Erkennen des Bedarfs an verlässlicher Software, der ökonomische Druck auf effizientere Methoden und die technische Machbarkeit. Die steigende Abhängigkeit unserer Gesellschaft von Software macht Fehler im Code immer gravierender, und die Kosten für Entwicklung steigen enorm. Gleichzeitig haben Fortschritte in Sprachen, formalen Methoden und Abstraktion die technischen Voraussetzungen geschaffen.Schließlich betont Dijkstra den einmaligen intellektuellen Anspruch, den die Programmierung an den Menschen stellt.
Mit Computern können wir Systeme bauen, die viele Ebenen von Abstraktion überbrücken und extrem hierarchisch aufgebaut sind. Diese Komplexität erfordert von uns Kreativität und Disziplin. Seine Vision war eine Zukunft, in der Programmierung nicht mehr nur ein mühseliges Handwerk, sondern eine so gut beherrschbare Disziplin wird, dass sie zu einem inspirierenden, kaum gekannten intellektuellen Vergnügen wird.Vom Beginn als kaum anerkannter Beruf bis zur kritischen Reflexion über Werkzeuge, Methoden und menschliche Grenzen hinterließ Dijkstras Rede eine fundamentale Botschaft für alle, die heute Software entwickeln. Der Programmierer der Zukunft, so sein Ideal, arbeitet mit Respekt vor den Herausforderungen, systematischer Strenge und der steten Bereitschaft zu lernen.
Er ist ein „Humble Programmer“ – bescheiden genug, um den Anforderungen gerecht zu werden, intelligent genug, um sie zu meistern.Diese Einsichten aus den frühen 1970er Jahren sind erstaunlich aktuell geblieben. Moderne Softwareentwicklung profitiert noch immer von den Lehren Dijkstras: Von modularer Architektur, formaler Verifikation, der Bedeutung einfacher und klarer Programmiersprachen bis hin zum Erkenntnisgewinn durch Abstraktion. In einer Welt, die noch abhängiger von Software wird, sind die Ideen des „Humble Programmer“ nicht nur relevant, sondern fundamentaler Bestandteil einer professionellen, verantwortungsvollen Herangehensweise an das Programmieren.Die Herausforderungen der Softwarekrise von damals spiegeln sich in heutigen Problemen wie technischer Schuld, Wartbarkeit und Qualitätssicherung wider.
Die Lösung, so Dijkstra, liegt weniger in immer komplexeren Werkzeugen, als vielmehr im methodischen und disziplinierten Ansatz des Entwicklers selbst. Die Zukunft der Programmierung bleibt somit eine Frage der geistigen Haltung, der richtigen Werkzeuge und der Akzeptanz der eigenen Grenzen – eine zeitlose Botschaft, die Programmierer weltweit inspirieren sollte.