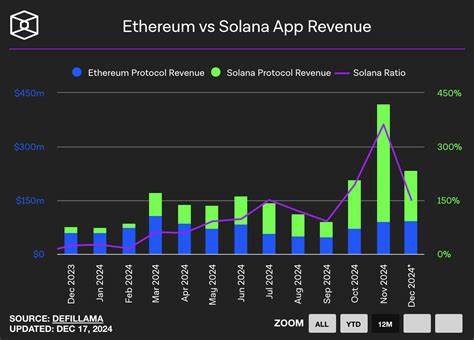Die Zukunft der Energieversorgung könnte bald ohne aufwendige Kabel- und Leitungsverlegungen auskommen – dank einer innovativen Technologie, die auf der Übertragung von Energie per Laserstrahl basiert. Die US-amerikanische Forschungsagentur DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) hat mit ihrem Persistent Optical Wireless Energy Relay (POWER) Programm neue Rekorde auf dem Gebiet der drahtlosen Stromübertragung erzielt. Diese Entwicklung markiert einen bedeutenden Meilenstein, der nicht nur militärische Operationen effizienter gestalten könnte, sondern auch im zivilen Bereich neue Möglichkeiten in der Energieversorgung eröffnet. Traditionell stellt die Versorgung mit elektrischer Energie in abgelegenen oder schwer zugänglichen Gegenden eine erhebliche logistische Herausforderung dar. Besonders für Militärs und Hilfsorganisationen ist es oft problematisch, zuverlässige Stromquellen zu gewährleisten.
Lange Versorgungsleitungen sind anfällig für Beschädigungen und die Lieferung von Treibstoff oder Batterien erfordert Ressourcen und Zeit, die in kritischen Situationen knapp sind. In diesem Zusammenhang setzt DARPA auf eine Technologie, die Strom quasi durch die Luft transportieren kann – und zwar mithilfe von Laserstrahlen. Die Idee, Energie per Laser über größere Distanzen zu übertragen, ist nicht neu. In der Vergangenheit waren jedoch die technische Umsetzung und die erreichbare Reichweite sowie Leistung derartiger Systeme stark limitiert. Die bisherigen Versuche hätten zum Beispiel Energie in relativ geringem Umfang und nur über kurze Entfernungen senden können.
Doch DARPA hat nun neue Maßstäbe gesetzt: In aktuellen Tests gelang es, 800 Watt elektrische Leistung über eine Distanz von 5,3 Meilen beziehungsweise etwa 8,6 Kilometern zu übertragen – und das für eine Dauer von 30 Sekunden. Zum Vergleich: Bei früheren Tests waren lediglich 230 Watt über eine Meile (1,7 Kilometer) möglich. Der Kern des DARPA-Systems ist die sogenannte Power Receiver Array Demo (PRAD). Dabei handelt es sich um eine kugelförmige Konstruktion, die eine spezielle Öffnung besitzt, durch die der Laserstrahl eintreten kann. Im Inneren sorgt ein parabolischer Spiegel dafür, dass der eingehende Lichtstrahl gestreut und auf eine Vielzahl von Photovoltaikzellen gerichtet wird.
Diese Zellen wandeln die Energie des Laserlichts zurück in elektrische Energie um. Aktuell liegt die Effizienz des Systems bei etwa 20 Prozent, was für Demonstrationszwecke akzeptabel ist, jedoch als Ausgangspunkt für weitere Optimierungen dient. In den bislang durchgeführten Bodentests war der Sender ebenso wie der Empfänger stationär auf dem Boden positioniert. Das ultimative Ziel von DARPA ist es jedoch, diese Technologie auf fliegende Plattformen wie Drohnen oder Flugzeuge zu verlagern. Diese würden in großer Höhe, oberhalb der dicksten Atmosphäre und Hindernisse wie Gebäude oder Bäume, positioniert werden, wodurch der Energieverlust auf dem Übertragungsweg minimiert wird.
Außerdem lassen sich so störende Einflüsse wie Wetterbedingungen oder Hindernisse im Sichtlinie reduzieren, was die Zuverlässigkeit und Effizienz des Systems deutlich erhöht. Das POWER-Programm befindet sich derzeit in der ersten von insgesamt drei Entwicklungsphasen. Hier stehen das präzise und effiziente Ausrichten der Laserstrahlen, die Korrektur von Wellenfronten zur Verbesserung der Strahlqualität sowie Techniken zur Steuerung der Leistungsabgabe im Fokus. Zudem arbeitet das Team daran, die Verluste bei der Umwandlung der optischen Energie in Strom zu minimieren, um die Gesamtleistung der Übertragung zu steigern. Langfristig plant DARPA, auf herkömmlichen Flugzeugen oder Drohnen Energierelais anzubringen, die in der Lage sind, bis zu 10 Kilowatt optische Energie über Entfernungen von bis zu 125 Meilen beziehungsweise 200 Kilometern zu übertragen.
Eine solche Reichweite und Leistung würde die drahtlose Energieversorgung auch für große Einsatzgebiete und vielseitige Anwendungen möglich machen. Die technischen Herausforderungen in diesem Bereich sind jedoch nicht gering. So müssen etwa atmosphärische Störungen wie Dunst, Rauch, Staub oder Feuchtigkeit die Übertragung so gut wie möglich unbeeindruckt lassen, da solche Bedingungen die Durchlässigkeit für Laserstrahlen reduzieren können. Auch die Sicherheit spielt eine wichtige Rolle. Laser mit hoher Leistungsdichte können potenziell gesundheitsschädlich sein, weshalb das System so ausgelegt sein muss, dass keine Gefahr für Personen oder Tiere besteht, die sich in oder nahe dem Übertragungsweg aufhalten.
Nicht zuletzt stellt die Skalierung der Technologie hin zu nutzbaren Leistungsgrößen und kontinuierlichem Betrieb einen weiteren kritischen Schritt dar. Zum jetzigen Zeitpunkt ermöglichen die Testergebnisse die kurzfristige Versorgung von kleinen Geräten wie Mobiltelefonen oder Sensoren. In Zukunft könnten jedoch auch größere Verbraucher oder sogar ganze Basislager ohne herkömmliche Energieinfrastruktur mit Strom versorgt werden. Der strategische Wert der Initiative für das Militär ist enorm. Logistik-Ketten, die oft enormen Aufwand und Ressourcen erfordern, könnten deutlich vereinfacht werden.
Soldaten müssten weniger schwere Ausrüstung transportieren, und wichtige Geräte könnten ihre Energieversorgung kontinuierlich aufrechterhalten, unabhängig von Gelände oder Wetter. Auch bei humanitären Einsätzen in Katastrophenregionen oder abgelegenen Gebieten böte drahtlose Energieübertragung enorme Vorteile, da vor Ort keine komplexen Infrastrukturmaßnahmen nötig wären. Über den militärischen Nutzen hinaus birgt die Forschung im Bereich drahtloser Laser-Energieübertragung auch zivilgesellschaftliche Potenziale. In Zeiten des globalen Ausbaus erneuerbarer Energien, Elektromobilität und digitaler Vernetzung könnte die Technologie bahnbrechende Veränderungen im Energiemanagement bewirken. Zum Beispiel könnten entlegene Siedlungen, Forschungsstationen oder Inseln künftig ohne Kabel und aufwendige Netze mit Strom versorgt werden.
Auch in urbanen Umgebungen könnten durch flexible Energieübertragung neue Konzepte für Gebäudeversorgung und smarte Stromnetze entstehen. Zudem steht die Weiterentwicklung von Lasertechnologien selbst im Fokus vielfältiger industrieller Anwendungen. Von der Präzisionsfertigung über Kommunikation bis hin zur medizinischen Nutzung gewinnen die Möglichkeiten, Licht gezielt, effizient und sicher einzusetzen, stetig an Bedeutung. Die Fortschritte bei der drahtlosen Energieübertragung per Laser spiegeln diese Tendenz wider und erweitern das Spektrum innovativer Lösungsansätze. Kritiker der drahtlosen Energieübertragung weisen allerdings auf potenzielle Herausforderungen hin.
Neben den erwähnten atmosphärischen Einflüssen und Sicherheitsaspekten bleibt etwa die Frage der Wirtschaftlichkeit im praktischen Betrieb. Die Herstellung und Wartung der komplexen Empfänger- und Sendertechnologie, der Energieverlust durch Umwandlungsprozesse sowie regulatorische Rahmenbedingungen müssen ebenfalls berücksichtigt werden, bevor flächendeckende und kommerzielle Nutzung denkbar ist. Dennoch verweisen Experten darauf, dass technologischer Fortschritt häufig gerade bei der Überwindung solcher Hürden neue Möglichkeiten eröffnet. Die jüngsten Erfolge von DARPA könnten eine Initialzündung sein, die nicht nur das Militär, sondern auch Industrie und Wissenschaft wachrüttelt. Die Industrie beginnt, sich neu auszurichten und innovative Konzepte für die drahtlose Energieversorgung zu entwickeln, die bis vor Kurzem noch als Zukunftsmusik galten.
Die Vision eines Energienetzes, das ohne Kabel und Leitungen auskommt, rückt damit greifbar näher als je zuvor. Wenn es gelingt, die Effizienz zu steigern, die Reichweite zu erhöhen und die Übertragung sicher und kosteneffizient zu gestalten, könnte die drahtlose Energieübertragung mittels Laserstrahlen eines der bedeutendsten technischen Paradigmen unserer Zeit werden. Die Entwicklungen des POWER-Programms zeigen eindrucksvoll, wie die Verbindung von moderner Optik, Photovoltaik und aerodynamischen Trägerplattformen neue Horizonte öffnet. Die nächsten Jahre werden entscheidend sein, um die Prototypen in die Praxis zu überführen und im großen Maßstab nutzbar zu machen. Abschließend lässt sich sagen, dass DARPA mit seiner laserbasierten drahtlosen Energieübertragung einen Schlüssel für eine flexiblere, effizientere und nachhaltigere Energieversorgung schafft.
Die Potentiale reichen weit über den militärischen Bereich hinaus und könnten unser Verständnis von Energieverteilung und Infrastruktur grundlegend verändern. Die nächsten Etappen des Projekts werden mit Spannung erwartet – mit der Hoffnung, dass diese Technologie bald in vielfältigen Bereichen eingesetzt werden kann und so neue Wege für die Energieversorgung der Zukunft eröffnet.



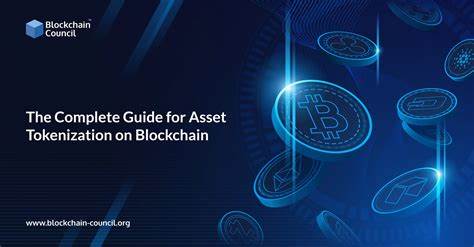

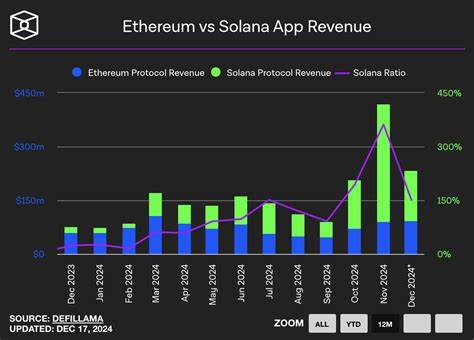


![Tetris founder's family village is collapse-proof, remote offgrid-topia [video]](/images/85A2712D-384D-40E5-9584-F3CB069E37BD)