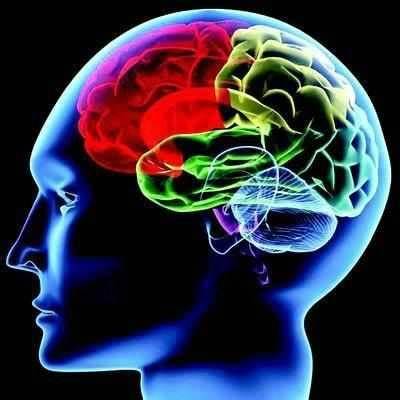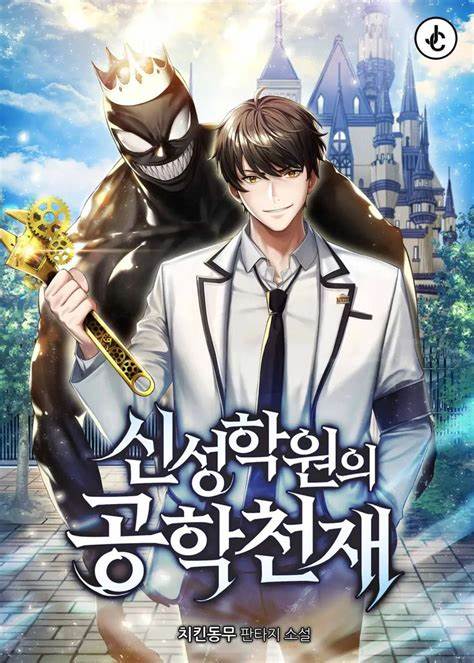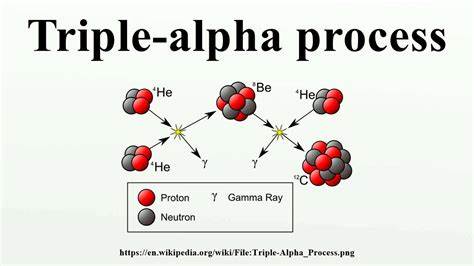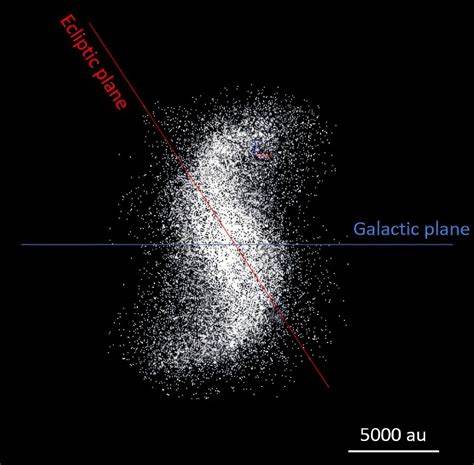Die Fähigkeit des Gehirns, sich an neue Herausforderungen und Erfahrungen anzupassen, war lange Zeit ein zentrales Thema der Neurowissenschaften. Die sogenannte Gehirnplastizität, also die Fähigkeit von Nervenzellen, ihre Verbindungen zu verändern und neu zu formen, gilt als Grundlage für Lernen, Gedächtnis und geistige Gesundheit. Bislang ging man davon aus, dass spontane und ausgelöste neuronale Signale durch gemeinsame synaptische Übertragungsstellen vermittelt werden. Doch eine aktuelle Studie der University of Pittsburgh erschüttert dieses seit Jahrzehnten fest verankerte Verständnis und offenbart eine deutlich differenziertere Wirkungsweise der synaptischen Kommunikation im Gehirn. Forscher unter der Leitung von Oliver Schlüter, Associate Professor für Neurowissenschaften an der Kenneth P.
Dietrich School of Arts and Sciences, konnten anhand von Mausmodellen nachweisen, dass das Gehirn für spontane und evokative Signalübertragung verschiedene, funktionell getrennte synaptische Stellen verwendet. Diese Erkenntnis hat weitreichende Konsequenzen für unser Verständnis der neuronalen Plastizität und der zugrundeliegenden Mechanismen, die Stabilität und Anpassungsfähigkeit im Gehirn gewährleisten. Die Forschung wurde in der renommierten Fachzeitschrift Science Advances veröffentlicht und stellt einen Meilenstein in der neurologischen Forschung dar. Die Kommunikation zwischen Neuronen erfolgt über die sogenannte synaptische Übertragung: Ein Neuron gibt chemische Botenstoffe, die Neurotransmitter, an einem präsynaptischen Terminal frei. Diese wandern durch den synaptischen Spalt und binden an Rezeptoren des postsynaptischen Neurons, was dessen Aktivität beeinflusst.
Bisher nahm die Wissenschaft an, dass spontane Übertragungssignale – solche, die zufällig ohne äußeren Reiz auftreten – und evokative Signale, also durch sensorische Reize ausgelöste Übertragungen, über dieselbe synaptische Struktur laufen und dieselbe molekulare Maschinerie nutzen. Die Studie von Schlüter und seinem Team widerlegt diese Annahme und zeigt, dass verschiedene synaptische Transmissionsstellen mit eigenständigen Entwicklungs- und Regulationsmechanismen vorhanden sind. Im Fokus der Untersuchung stand die primäre visuelle Hirnrinde, welche den Beginn der komplexen visuellen Informationsverarbeitung im Cortex markiert. Ein zentrales Interesse lag darin zu verstehen, wie spontane und evokative synaptische Signale sich im Verlauf der Entwicklung nach dem Öffnen der Augen verändern und welche Rolle sie für die neuronale Anpassung spielen. Die Ergebnisse zeigten eine deutliche Divergenz im Verlauf der Entwicklung: Während die evokativen Übertragungen mit der Aufnahme visueller Informationen stetig an Stärke gewannen, erreichten die spontanen Signale bald einen stabilen Plateauwert.
Diese Beobachtung legt nahe, dass das Gehirn unterschiedliche Kontrollmechanismen auf diese beiden Signaltypen anwendet, um einerseits eine konstante Grundaktivität sicherzustellen und andererseits die Verbindungen, die auf aktive Erfahrung und Lernen reagieren, selektiv zu stärken. Eine weitere wichtige experimentelle Erkenntnis gelang den Forschern durch den Einsatz eines chemischen Wirkstoffs, der inaktive Rezeptoren auf der postsynaptischen Seite aktiviert. Diese Pharmakologische Intervention bewirkte einen Anstieg der spontanen Aktivität, während die evokative Übertragung unbeeinflusst blieb. Diese Befunde bestätigen die funktionelle Trennung der beiden Übertragungssysteme und deuten auf spezifische molekulare Unterschiede in den jeweiligen synaptischen Strukturen hin. Die Existenz einer solchen dualen Synapsenstruktur erlaubt dem Gehirn, eine stabile Grundaktivität durch spontane Signale aufrechtzuerhalten, welche für das neuronale Gleichgewicht und die Homöostase entscheidend ist.
Gleichzeitig kann es über die evokativen Übertragungen flexibler auf neue Lernerfahrungen reagieren, indem es relevante neuronale Verbindungen gezielt verstärkt – ein Phänomen, das als Hebb’sche Plastizität bekannt ist. Die Kombination aus Stabilität und Anpassungsfähigkeit stellt somit eine Kernstrategie für effizientes Lernen und Gedächtnisbildung dar. Darüber hinaus eröffnen die Ergebnisse neue Perspektiven für das Verständnis neurologischer und psychiatrischer Erkrankungen. Störungen im synaptischen Signalverkehr werden beispielsweise mit Autismus, Alzheimer und Suchterkrankungen in Verbindung gebracht. Ein genaueres Wissen über die getrennte Regulation der spontanen und evokativen Signalübertragung könnte helfen, die pathologischen Prozesse besser zu verstehen und letztlich gezieltere therapeutische Ansätze zu entwickeln.
Laut Yue Yang, der Erstautorin der Studie und Forschungsassistentin an der Universität, bringt das Verständnis dieser doppelten Signalisationswege die Wissenschaft einen wichtigen Schritt näher daran, herauszufinden, was im kranken Gehirn aus dem Gleichgewicht gerät. Die Forschungsförderung für diese Arbeit wurde unter anderem durch die National Institutes of Health, die Alzheimer’s Association und verschiedene internationale Stiftungen sowie Strategien aus Deutschland ermöglicht. Das neue Modell der getrennten synaptischen Übertragung fordert etablierte Vorstellungen heraus und legt den Grundstein für künftige Untersuchungen, die das komplexe Zusammenspiel neuronaler Signale noch detaillierter erforschen. Für Forscher, Mediziner und all jene, die sich für das Potenzial des Gehirns interessieren, bedeutet dies einen bedeutenden Fortschritt, der nicht nur die wissenschaftliche Landschaft verändert, sondern auch das Potenzial bietet, das menschliche Gehirn und seine Leistungsfähigkeit in einem neuen Licht zu sehen. Insgesamt liefert die Studie der University of Pittsburgh überzeugende Beweise dafür, dass das Gehirn eigenständige synaptische Strategien nutzt, um Stabilität und Flexibilität optimal zu balancieren.
Dieses Verständnis bringt neue Impulse für die Erforschung kognitiver Eigenschaften und neurologischer Krankheiten und öffnet Türen für innovative Ansätze in der Neurotherapie und der Bildung von Lernmethoden.