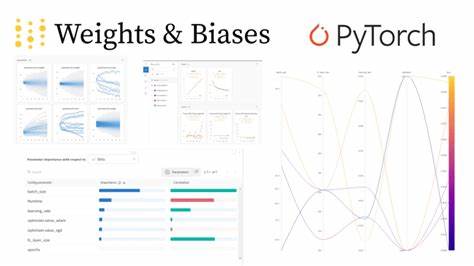In den letzten Jahren zeichnet sich ein besorgniserregender Trend ab: Wissenschaftliche Konferenzen und akademische Tagungen, die traditionell in den Vereinigten Staaten stattfinden, werden zunehmend verschoben, abgesagt oder an andere Orte verlegt. Die Ursache dafür liegt in den verschärften Einreisebestimmungen der USA, die vor allem ausländische Forscherinnen und Forscher verunsichern und ihre Teilnahme an wissenschaftlichen Veranstaltungen erschweren. Die Angst vor Durchsuchungen, langen Wartezeiten an den Grenzen und sogar Festnahmen nehmen zu und beeinflussen die internationale Wissenschaftsgemeinschaft nachhaltig. Der amerikanische Wissenschaftsstandort galt jahrzehntelang als globaler Treffpunkt für Innovation und Forschung. Insbesondere Konferenzen in Top-Forschungszentren wie Boston, San Francisco oder New York waren Magneten für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt.
Die Möglichkeit des persönlichen Austauschs, das Knüpfen internationaler Kontakte sowie das Präsentieren neuester Forschungsergebnisse sind essenziell für die wissenschaftliche Entwicklung und den Fortschritt. Nun aber scheinen diese etablierten Formate zu leiden, weil viele Wissenschaftlerinnen aus Angst vor den harten Kontrollmaßnahmen ihre Teilnahme infrage stellen oder absagen. Die verschärften Grenzkontrollen sind eingebettet in eine politische Atmosphäre, die durch strengere Einwanderungsgesetze und eine intensive Überwachung geprägt ist. Dies führt dazu, dass ausländische Forschende vor allem aus bestimmten Regionen oder Ländern von zusätzlichen Sicherheitsprüfungen betroffen sind. Auch die Unsicherheit über die Anerkennung von Visa, die Dauer und Komplexität der Beantragung sowie individuelle Erfahrungen von Forschenden, die an der Grenze in unangenehme Situationen geraten sind, tragen zu einer spürbaren Ablehnung bei.
Diese Bedenken hemmen nicht nur die Reisebereitschaft, sondern werfen zudem ein negatives Licht auf die USA als Wissenschaftsstandort. Ein besonderes Problem ist die fehlende Transparenz und Vorhersehbarkeit im Prozess der Grenzkontrollen. Forscherinnen und Forscher wissen oft nicht, ob sie bei der Einreise Probleme bekommen oder ob ihre elektronischen Geräte, wie Laptops und Smartphones, gründlich durchsucht werden. Dies birgt die Gefahr, vertrauliche Forschungsdaten zu verlieren oder Einblicke in laufende Projekte zu gewähren, was in vielen Fällen nicht nur persönlich, sondern auch beruflich fatal sein kann. Die Angst vor solchen Eingriffen motiviert viele, Konferenzen im Ausland oder virtuelle Alternativen zu bevorzugen.
Die Reaktionen der Organisatorinnen und Organisatoren der wissenschaftlichen Veranstaltungen sind vielfältig. Einige große Kongresse haben bereits begonnen, ihre Austragungsorte zu verlegen – nach Europa, Asien oder Kanada. Diese Regionen gelten als sicherer und einladender für internationale Gäste und bieten vergleichbare Infrastrukturen und Netzwerkmöglichkeiten. Andere Veranstalter entscheiden sich für hybride Formate oder setzen verstärkt auf digitale Konferenzen, um die Teilnahmebarrieren zu minimieren und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern weltweit eine Plattform zu bieten. Der Wechsel von Konferenzen aus den USA weg hat allerdings weitreichende Folgen.
Zum einen verliert der US-Wissenschaftsstandort an internationaler Sichtbarkeit und Durchlässigkeit. Die beste Forschung fußt auf Kooperation, und wenn der persönliche Austausch eingeschränkt wird, leidet die Innovationskraft. Zum anderen trifft es nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern auch die Wirtschaft, etwa durch reduzierte Möglichkeiten für den Technologietransfer, die Zusammenarbeit mit Start-ups und neue Impulse aus Forschung und Entwicklung. Darüber hinaus schadet diese Entwicklung dem wissenschaftlichen Nachwuchs aus aller Welt, der auf den persönlichen Kontakt zu renommierten Forschenden und Professorinnen sowie auf Karrierechancen durch Auftritte auf internationalen Konferenzen angewiesen ist. Junge Talente könnten sich zunehmend gegen die USA entscheiden und alternative Karrierewege in anderen Ländern oder Regionen suchen, was langfristig zu einem Brain-Drain führen kann.
Die US-Politik steht damit vor einer entscheidenden Herausforderung: Wie lassen sich notwendige Sicherheitsmaßnahmen mit einer offenen und zugänglichen Wissenschaftskultur vereinbaren? Experten schlagen vor, klare Richtlinien für den Umgang mit internationalen Forschenden und deren digitalen Daten an den Grenzen zu etablieren. Es wird ebenso gefordert, die Visa- und Einreiseprozesse zu vereinfachen und den wissenschaftlichen Austausch als wichtigen Faktor der nationalen Innovationsstrategie anzuerkennen. Internationale Wissenschaftsorganisationen und Universitäten engagieren sich bereits aktiv, um deren Mitgliedern Sicherheit und Transparenz zu bieten. Dabei spielt auch die verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Ländern und die Förderung digitaler Netzwerke eine bedeutende Rolle, um den negativen Folgen der US-Grenzpolitik entgegenzuwirken. Nicht zuletzt sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst zu mehr Solidarität aufgerufen.
Der Aufbau von globalen digitalen Gemeinschaften kann als Brücke dienen und die Abhängigkeit von physischer Präsenz in einzelnen Ländern verringern. Trotzdem bleibt die Sehnsucht nach persönlichem Austausch und direkter Kommunikation bestehen, weshalb flexible und grenzübergreifende Konzepte in Zukunft von großer Bedeutung sein werden. Abschließend lässt sich festhalten, dass der Trend, wissenschaftliche Konferenzen aus den USA wegzubewegen, ein Symptom für tiefere politische und gesellschaftliche Umwälzungen ist, die auch vor der Wissenschaft nicht Halt machen. Die USA verlieren dadurch an Anziehungskraft als internationaler Wissenschafts-Hub. Dies sollte als Warnung verstanden werden, denn Wissenschaft funktioniert nur im Miteinander, im gegenseitigen Vertrauen und in einer offenen Kommunikationskultur.
Für die Zukunft gilt es, Wege zu finden, um Institutionen und Forschende weltweit zu vernetzen, damit Wissen frei fließen und Innovation gedeihen kann – unabhängig von Grenzen und politischen Barrieren.



![Mr. Bates vs. the Post Office [TV Series] (Horizon IT Scandal)](/images/7530B813-1461-4010-A359-18A57DC00D48)