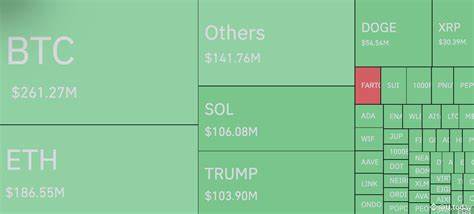Der Digital Services Act (DSA) der Europäischen Union wurde 2022 eingeführt, um das Online-Ökosystem strenger zu regulieren und die Verantwortung großer digitaler Plattformen für schädliche Inhalte und illegale Aktivitäten zu erhöhen. Als Teil dieser Regulierung erhebt die EU eine Überwachungsgebühr von großen Online-Plattformen, um die Kosten für deren Aufsicht und die Durchsetzung der neuen Regeln zu finanzieren. Diese Gebühr beträgt 0,05 % des jährlichen globalen Nettoumsatzes der Unternehmen und orientiert sich zusätzlich an der Zahl der monatlich aktiven Nutzer in Europa. Die jüngste juristische Herausforderung dieser Gebühr durch die internationalen Technologiegiganten Meta Platforms und TikTok sorgt für bedeutende Diskussionen über Gerechtigkeit, Transparenz und die Methodik solcher finanziellen Verpflichtungen seitens der regulatorischen Behörden. Meta und TikTok, zwei der größten sozialen Medienunternehmen weltweit, haben gemeinsam Klage gegen die Europäische Kommission eingereicht.
Der Kernpunkt des Rechtsstreits liegt in der Art und Weise, wie die Gebühr berechnet wurde und ob diese Berechnungsmethode angemessen ist. Meta argumentiert, dass die Berechnung auf dem Gesamtumsatz der gesamten Unternehmensgruppe basiert und nicht nur auf den Umsätzen der europäischen Tochtergesellschaften, was zu einer überhöhten und unangemessenen Belastung führt. Assimakis Komninos, Rechtsvertreter von Meta, betonte in der Verhandlung vor dem Generalgericht, dass es Meta keineswegs darum gehe, finanzielle Verantwortung zu vermeiden. Vielmehr kritisiert er die fehlende Transparenz und die „Black Box“-ähnliche Herangehensweise an die Berechnung der Gebühr. Diese führte laut Komninos zu „völlig unplausiblen und absurden Ergebnissen“ und stehe im Widerspruch zur „Buchstaben und Geist“ des Gesetzes.
Auch TikTok, das zur chinesischen ByteDance-Gruppe gehört, teilt diese Bedenken. Ihr Anwalt Bill Batchelor beschrieb die Vorgehensweise der EU als unfair und unverhältnismäßig. Insbesondere wird kritisiert, dass die Nutzerzahlen nicht korrekt erfasst wurden: Die EU soll Nutzerdaten so ausgewertet haben, dass dieselbe Person, die auf verschiedenen Geräten aktiv ist, mehrfach gezählt wird. Dies führe zu einer doppelten Berechnung der Nutzerbasis, was laut Batchelor diskriminierend sei. Auch die Festlegung einer Gebührendeckelung auf Basis konzernweiter Gewinne wird als rechtswidrig dargestellt.
TikTok sieht sich somit zu Unrecht einer höheren finanziellen Last ausgesetzt, die weder den Tatsachen noch der wirtschaftlichen Realität entspricht. Die Europäische Kommission verteidigt hingegen ihr Vorgehen vehement. Ihre Vertreterin Lorna Armati macht deutlich, dass bei Unternehmensgruppen mit konsolidierten Abschlüssen die Finanzmittel der gesamten Gruppe betrachtet werden müssen, da diese Ressourcen dem Unternehmen tatsächlich verfügbar sind, um die Gebühr zu tragen. Dies sei ein logischer und transparenter Ansatz, den alle betroffenen Anbieter nachvollziehen können. Die Kommission betont außerdem, dass die Unternehmen ausreichend Informationen hatten, um die Berechnungsweise der Gebühr zu verstehen, und dass keine Rechte verletzt wurden.
Die gesamte Vorgehensweise sei im Einklang mit den Regeln des DSA und der EU-Gesetzgebung. Die Rechtsstreitigkeiten werfen ein Schlaglicht auf die Herausforderungen, die entstehen, wenn globale Tech-Konzerne mit den europäischen Regulierungen kollidieren. Die neuen Vorgaben des DSA gehen weit über bisherige Regelungen hinaus und stellen die Plattformen vor komplexe Compliance-Anforderungen. Zugleich müssen die Regulierungsbehörden Mittel finden, diese Überwachungs- und Kontrollstrukturen zu finanzieren, ohne die Unternehmen unverhältnismäßig zu belasten oder gar deren Wettbewerbsfähigkeit einzuschränken. Die Bedeutung dieser juristischen Auseinandersetzung geht weit über die beteiligten Unternehmen hinaus.
Sollten Meta und TikTok vor Gericht Recht bekommen, könnte dies die Ausgestaltung künftiger Gebühren und Regulierungen im digitalen Bereich maßgeblich beeinflussen. Es könnte bedeuten, dass die EU ihre Methoden überdenken und transparentere sowie gerechtere Berechnungsweisen entwickeln muss. Andererseits würde ein Sieg der Kommission die bisherige Regulierung festigen und den technologischen Giganten signalisieren, dass die neue Ära der Online-Kommunikationsregulierung keine Ausnahmen duldet. Bereits im Vorfeld des Rechtsstreits war klar, dass die regulatorischen Eingriffe der EU tiefgreifende Auswirkungen auf die digitale Wirtschaft haben. Neben Meta und TikTok setzen auch andere große Unternehmen und Verbände die EU-Regulierung kritisch mit Blick auf Wettbewerbsfähigkeit, Innovationsdruck und Datenschutz.
Dennoch hält die EU am Ziel fest, einen sichereren, transparenteren und faireren digitalen Markt zu schaffen, in dem Nutzerrechte gestärkt und Missbrauchsrisiken minimiert werden. Meta hat sich parallel zur Klage aggressiv im Technologiebereich weiterentwickelt. Kürzlich erwarb das Unternehmen eine bedeutende Beteiligung von 49 % am US-amerikanischen KI-Startup Scale AI im Wert von 14,8 Milliarden US-Dollar. Dieses Investment unterstreicht Metas Ambition, seine Position in der Künstlichen Intelligenz zu stärken und innovative Produkte voranzutreiben – ein Bereich, der auch stark von regulatorischen Vorgaben betroffen sein könnte. Aus Sicht der europäischen Gesetzgeber ist der Digital Services Act ein zentrales Instrument, das die Macht großer Plattformen kontrollieren und einen faireren Wettbewerb ermöglichen soll.
Die Überwachungsgebühr soll dabei helfen, die Ressourcen der EU für eine konsequente Aufsicht zu finanzieren. Allerdings zeigt die Klage von Meta und TikTok, dass selbst solche finanztechnischen Maßnahmen nicht ohne kontroverse Debatten und juristische Überprüfungen bleiben. Das Verfahren vor dem Generalgericht wird mit Spannung erwartet, da es die Zukunft der digitalen Regulierung in der EU mitbestimmen kann. Abschließend lässt sich sagen, dass der Konflikt zwischen den weltgrößten Social-Media-Konzernen und der EU über die Höhe und Berechnung der DSA-Gebühr ein prägendes Beispiel für die komplexen Wechselwirkungen zwischen Recht, Technologie und Wirtschaft ist. Die Balance zwischen effektiver Regulierung und wirtschaftlicher Vernunft bleibt eine der größten Herausforderungen des digitalen Zeitalters.
Insbesondere in einer Zeit, in der digitale Plattformen immer mehr Bereiche unseres Alltags beeinflussen, ist eine klare, transparente und faire Gesetzgebung grundlegend, um das Vertrauen der Nutzer und den Wettbewerb zu sichern. Die Entscheidung des Generalgerichts in der kommenden Zeit wird daher mit großem Interesse verfolgt, da sie möglichen Präzedenzcharakter für weitere Fälle haben könnte. Ob diese gebührenrechtliche Auseinandersetzung in einem Kompromiss endet oder eine grundlegende Reform anstößt, wird zeigen, wie Europa den digitalen Wandel gestaltet und welche Rolle die großen Tech-Plattformen dabei spielen werden.