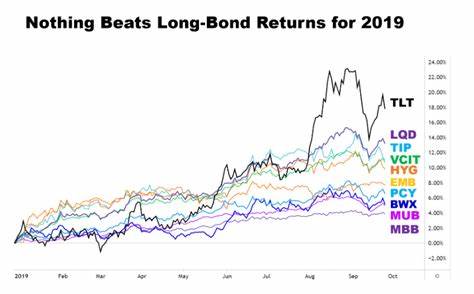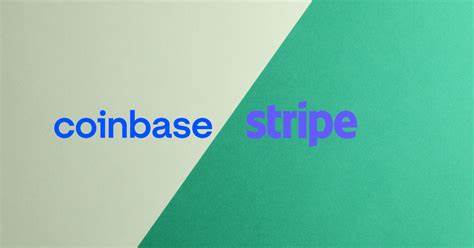In einer scheinbar fairen Situation, in der eine Gruppe von Menschen wiederholt untereinander Geld zufällig weitergibt, würde man intuitiv erwarten, dass das Geld irgendwann gleichmäßig verteilt ist. Doch überraschenderweise zeigen mathematische Modelle und Simulationen, dass genau das Gegenteil passiert: Aus einfachen, zufälligen Transfers entsteht sehr schnell eine erhebliche Ungleichheit in der Vermögensverteilung. Dieses Phänomen wirft wichtige Fragen nicht nur aus mathematischer Sicht auf, sondern gibt auch Einblicke in die Dynamiken hinter sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten. Stellen wir uns eine Gruppe von 100 Personen vor, von denen jede anfangs 100 Dollar besitzt. In jedem Moment muss jeder, der Geld hat, genau einen Dollar an eine zufällig ausgewählte andere Person geben.
Auf den ersten Blick scheint dieses Verfahren vollkommen fair zu sein. Jeder hat die gleichen Chancen sowohl Geld zu erhalten als auch abzugeben. Man könnte leicht davon ausgehen, dass das Vermögen nach einiger Zeit wieder gleichmäßig verteilt ist – aber das stimmt nicht. Simulierte Experimente zeigen, dass das Vermögen sehr ungleich wird, obwohl der Prozess komplett zufällig und symmetrisch verläuft. Der Grund für dieses unerwartete Verhalten liegt in den zugrundeliegenden mathematischen Strukturen.
Der Zustand des Systems zu einem bestimmten Zeitpunkt lässt sich als eine Verteilung von Geldbeträgen auf 100 Personen beschreiben, die alle zusammen die gesamte Geldmenge bilden. Diese Zustände bilden einen sogenannten Gitterpunkt in einem Simplex, einem geometrischen Objekt, das alle möglichen nicht-negativen Verteilungen mit einer konstanten Summe darstellt. Der Prozess des Geldgebens wird als zufälliger Spaziergang auf einem Graphen modelliert, dessen Knoten für diese Verteilungen stehen. Eine Kante zwischen zwei Knoten repräsentiert den Wechsel von einem Geldverteilungszustand zum nächsten, wenn eine Person einen Dollar an eine andere weitergibt. Der Zufallsprozess ist somit eine Markov-Kette auf diesem komplexen Graphen.
In vielen Zufallsszenarien führt ein solcher Prozess nach langer Zeit zu einer Gleichverteilung auf den möglichen Zuständen, insbesondere wenn der Graph regulär ist – das heißt, alle Knoten haben die gleiche Anzahl von Verbindungen. Im gegebenen Fall ist der Graph jedoch nicht regulär: Einige Zustände, bei denen niemand pleite ist, haben mehr Verbindungen als Zustände, in denen einige Personen kein Geld mehr besitzen. Insbesondere sogenannte „Pleitezustände“ (Personen mit Null Dollar) haben weniger Nachbarzustände. Durch dieses Ungleichgewicht in den Verbindungen gewinnt der Prozess eine Tendenz dazu, in Regionen des Graphen zu verweilen, die von einigen sehr reichen und vielen sehr armen Personen geprägt sind. Gleichzeitig schwankt das Vermögen einzelner Personen mit der Zeit, aber die allgemeine Ungleichheit bleibt bestehen.
Das erklärt, warum trotz absoluter Fairness in der Verteilungsmethode Ungleichheit entsteht und bestehen bleibt. Interessant ist auch die Frage, wie extrem die Ungleichheit wird. Betrachtet man die Verteilung als Zufallspunkt im Simplex, so entspricht dies im kontinuierlichen Fall einem bekannten mathematischen Problem: Man zerschlägt einen Stock zufällig in 99 Stücke und fragt sich, wie lang das längste Stück durchschnittlich ist. Hier zeigt sich, dass die erwartete Länge des größten Teils proportional zu 100 mal dem natürlichen Logarithmus von 100 ist. Übertragen auf die Geldverteilung bedeutet das, dass der Reichste im Durchschnitt ein Vielfaches des durchschnittlichen Vermögens halten wird.
Eine weitere Beobachtung ergibt sich, wenn man die Situation variiert und nur jeweils 1 Dollar pro Person vorhanden ist. Nun ist es extrem wahrscheinlich, dass einige Personen zu jedem Zeitpunkt pleite sind. Dadurch wird die Uniformverteilung der Zustände noch stärker verzerrt und die Verteilung ähnelt bekannten Wahrscheinlichkeitsverteilungen, wie der Boltzmann-Verteilung aus der Physik, die in energetischen Systemen Ungleichheit beschreibt. Diese Erkenntnisse verdeutlichen, dass Zufälligkeit allein nicht vor Vermögensungleichheit schützt. Trotz gleichen Startkapitals und symmetrischer Transferrichtungen entstehen dynamisch ausgeprägte soziale Unterschiede.
Dies regt auch zu gesellschaftlicher Reflexion an, denn während das Modell selbstverständlich eine stark vereinfachte Abstraktion eines echten Wirtschaftssystems bleibt, so zeigt es doch gewisse inhärente Tendenzen in Systemen, deren Verteilung durch zufällige individuelle Transaktionen bestimmt wird. Kritisch ist außerdem die Frage, was unter Fairness verstanden wird. Im beschriebenen Modell ist Fairness mathematisch als Gleichbehandlung bei der Auswahl des Empfängers definiert. Aber realistisch betrachtet ist es fragwürdig, ob ein Mechanismus fair ist, der auch jemanden mit wenig oder keinem Geld zwingt, einen Dollar abzugeben. Diese Differenzierung hat wichtige Folgen für unsere Interpretation des Ergebnisses im Hinblick auf reale Gesellschaften.
Das Modell kann auch als Inspiration für vielfältige weitere Forschungen dienen. Beispielsweise wäre spannend zu untersuchen, wie Veränderungen in den Spielregeln – etwa Abschaffung der Pflicht zum Geben bei Pleite, Einführung von Mindest- oder Höchstbetragsbeschränkungen, oder Änderung der Empfängerauswahl von komplett zufällig zu teilweise bevorzugt – das Ungleichheitsbild beeinflussen. Außerdem öffnet sich ein Brückenschlag zur Physik und zu klassischen Modellen der statistischen Mechanik. Die Entdeckung, dass das Verteilungsmuster mit der Boltzmann-Verteilung übereinstimmen kann, verbindet ökonomische Fragestellungen mit tiefgehender Mathematik und theoretischer Physik. Die Beobachtung, dass im Laufe der Zeit einer Person eine immer größerer Anteil des Gesamtvermögens zufallen kann, bringt Parallelen zu realen Prozessen der Kapitalakkumulation in der Gesellschaft ins Spiel.
Es legt nahe, dass reine Marktmechanismen oder zufällige Transaktionen ohne Regulierung und Umverteilung zu Konzentrationen von Reichtum führen können. In der Summe zeigt das Gedankenexperiment, dass schon einfache, faire und zufällige Mechanismen komplexe Phänomene wie Ungleichheit erzeugen können. Dies fordert ein kritisches Verständnis von Fairness, Gerechtigkeit und der Rolle von Zufall in wirtschaftlichen und sozialen Systemen. Es liefert einen mathematisch fundierten Ausgangspunkt für Diskussionen über Wirtschaftspolitik, soziale Gerechtigkeit und die Struktur von Märkten. Der Blick in das mathematische und gesellschaftliche Geflecht hinter so einem scheinbar simplen Vorgang wie „Geld geben“ offenbart, dass alltägliche Phänomene oft durch tieferliegende Muster bestimmt werden.
Die Erkenntnisse regen an, über Mechanismen der Verteilung, Risiko und Chancen unter Menschen mit einer neuen, reflektierten Perspektive nachzudenken.