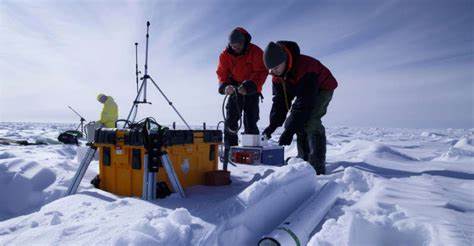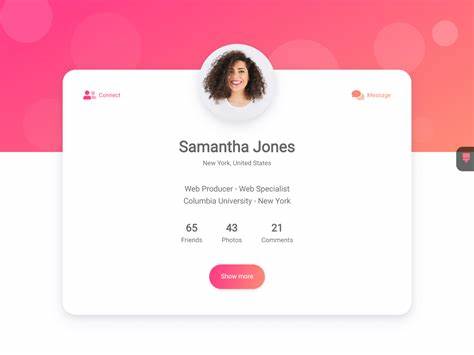Der weltweite Kampf gegen Wildtierkriminalität steht an einem kritischen Punkt. Jahrzehntelange Fortschritte in der Bekämpfung illegaler Wildtierhandelsnetzwerke geraten durch kürzliche Kürzungen von US-Fördermitteln massiv ins Wanken. Die Folgen sind dramatisch: Frontlinieneinheiten, Naturschutzprogramme und lokale Initiativen in Afrika, Südostasien und darüber hinaus drohen in ihrer Wirkung stark eingeschränkt zu werden. Die eingesetzte Unterstützung von Organisationen wie USAID, dem US Fish and Wildlife Service und weiteren Programmen war für viele Länder die entscheidende Säule im Kampf gegen organisierte Verbrecherbanden, die mit Elfenbein, Nashornhorn, Pangolinschuppen und anderen illegal gehandelten Tierprodukten Milliarden erwirtschaften. Ein besonders bedeutender Erfolg, der beispielhaft für die Wirksamkeit internationaler Hilfen stand, war die Zerschlagung des chinesisch geführten Lin-Zhang-Drogenkartells in Malawi im Jahr 2019.
Diese Organisation war eine der größten Wildtierhandels-Syndikate im südlichen Afrika. Zahlreiche Mitglieder wurden festgenommen und verurteilt, nachdem sie große Mengen Elfenbein und weitere bedrohte Tierprodukte illegal transportiert hatten. Diese Errungenschaft war nur möglich durch die Finanzierung und fachliche Unterstützung aus den USA, die den Aufbau von Überwachungseinrichtungen ermöglichte, Polizisten sowie Justizbeamte in Anti-Wildtierkriminalität schulte und den regionalen Artenschutz maßgeblich stärkte. Doch durch das plötzliche Einfrieren der Gelder in Folge politischer Entscheidungen der Trump-Regierung droht dieser Fortschritt nun zunichtegemacht zu werden. Die finanziellen Kürzungen betreffen gleichermaßen Initiativen in anderen Ländern.
In Tanzania musste etwa das Non-Profit-Unternehmen APOPO, das afrikanische Riesenhamsterratten als Spürhunde zur Erkennung illegaler Wildtiertransporte an Flughäfen einsetzt, seine Förderung komplett zurückziehen. Dieses Programm gilt als innovativer Ansatz, der bisher Erfolg bei der Aufdeckung von Schmuggelversuchen zeigte. Nun stehen die laufenden Tests und der Ausbau des Projekts auf der Kippe. Auch in Indonesien führten solche Finanzstreichungen zur Einstellung von Spürhund-Teams an Häfen, wodurch die Sicherheit gegen Wildtier-Schmuggel erheblich gelitten hat. Ähnliche Einschnitte wirken sich in Schutzgebieten Sumatra's aus, wo dringende Antiwilderer-Patrouillen reduziert werden mussten, während gleichzeitig vom Staat die Forstbehörden aus Kostengründen ebenfalls weniger Mittel erhalten.
Dies erhöht die Gefahr für Arten wie Orang-Utans, Tiger oder Nashörner, die in dieser Region akut vom Aussterben bedroht sind. Länder wie Thailand hingegen können zumindest noch auf staatliche Grundfinanzierung für ihre Wildhüter zurückgreifen, doch wichtige zusätzliche Unterstützung durch Organisationen wie der Wildlife Conservation Society (WCS) fällt weg. Unter ihrer Mithilfe konnten beispielsweise Bestände vom Indochinesischen Tiger stabilisiert werden, während er in benachbarten Ländern bereits ausgestorben ist. Der Wegfall der Finanzierung bringt nun nicht nur vielerorts den Bestandsschutz ins Wanken, sondern wirkt sich ebenso auf die Motivation und Ausbildung der Wildhüter aus – Elemente, die für effiziente Einsätze gegen Wilderer unabdingbar sind. Die Illegalität des Wildtierhandels ist eine der profitabelsten kriminellen Aktivitäten weltweit, mit einem geschätzten Jahresvolumen zwischen 7 und 23 Milliarden US-Dollar.
Dabei spielt vor allem die Rolle chinesischer organisierter Netzwerke eine Schlüsselrolle – ähnlich der von Drogenkartellen in anderen Feldern des organisierten Verbrechens. Experten betonen, dass die Reduzierung der US-Hilfen den Wildhändlern größeren Handlungsspielraum verschafft und gleichzeitig den Druck auf die chinesische Regierung verringert, eigene Gesetze konsequenter zu vollziehen. Es fällt international schwerer geworden, China zur Rechenschaft zu ziehen, wenn einer der bedeutendsten Länder Geldmittel und politisches Engagement aussetzt. Die Auswirkungen betreffen auch lokale Arbeitsmärkte. Die Kürzungen führen zu massiven Stellenstreichungen bei NGOs und Naturschutzorganisationen.
Viele Experten warnen, dass dies nicht nur kurzfristig den Kampf gegen Wildtierkriminalität schwächt, sondern langfristig Fachwissen verliert, das schwer zurückzugewinnen sein wird. Wenn hochqualifizierte Experten sich gezwungen sehen, den Bereich zu verlassen, könnte ein Generationsverlust an Wissen eintreten – gerade in einer Zeit, in der der Druck auf gefährdete Arten steigt. Die Suche nach Alternativen gestaltet sich schwierig. Während die Europäische Union mit einem kürzlich angekündigten 30-Millionen-Dollar-Projekt zur Unterstützung von Forensik und Strafverfolgung in Südostasien einen vielversprechenden Beitrag leisten möchte, reichen diese Mittel bei weitem nicht aus, um die Lücke zu füllen. Die globalen politischen Prioritäten verschieben sich zudem zunehmend hin zu Verteidigungsausgaben, was den Spielraum für Naturschutzfinanzierungen zusätzlich verengt.
Auch China oder andere Länder, die einzelne Bereiche der humanitären Entwicklungshilfe übernehmen, zeigen kaum Interesse daran, im Bereich Artenschutz eine vergleichbare Rolle einzunehmen. Die ungleiche Verteilung verfügbarer Mittel birgt zudem die Gefahr, dass große internationale NGOs mit umfangreichen Finanzierungsressourcen den Markt dominieren, während kleinere, lokale Organisationen, die mit den Realitäten vor Ort besser vertraut sind, abgehängt werden. Dies erschwert eine nachhaltige und gesellschaftlich akzeptierte Naturschutzarbeit, die besonders in komplexen, von Armut und gesellschaftlichen Konflikten geprägten Regionen überlebenswichtig ist. Aus finanzieller Not heraus könnte sich außerdem ein negativer Kreislauf verstärken: Wirtschaftliche Krisen und Arbeitsplatzverluste, wie zuletzt während der Corona-Pandemie zu beobachten, führen dazu, dass mehr Menschen auf illegale Jagd, Abholzung und Fischerei angewiesen sind, um ihre Existenz zu sichern. Dies erhöht wiederum den Druck auf ohnehin bedrohte Ökosysteme und gefährdete Tierarten.
Ein brisantes Szenario, das zeigt, wie eng soziale, wirtschaftliche und ökologische Herausforderungen miteinander verflochten sind. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, wie essenziell internationale Zusammenarbeit und eine verlässliche Finanzierung im Umwelt- und Artenschutz sind. Der Rückzug der USA, bisher einer der größten Unterstützer bei der Bekämpfung von Wildtierkriminalität, droht Jahrzehnte errungener Fortschritte zu zerstören und ein Machtvakuum zu schaffen, das skrupellose illegale Händler ausnutzen werden. Andere Staaten, private Stiftungen und die Zivilgesellschaft sind gefordert, diesen Verlust aufzufangen und zusammen mit den betroffenen Ländern und lokalen Gruppen neue, nachhaltige Wege zu finden, um den illegalen Wildtierhandel zu stoppen. Der Schutz von Elefanten, Nashörnern, Tigern, Pangolinen und vielen weiteren Arten wird entscheidend davon abhängen, ob diese globale Herausforderung als dringendes Problem anerkannt und entsprechend priorisiert wird.
Zeitdruck besteht, denn die Artenvielfalt ist in vielen Regionen der Welt schon heute akut bedroht und der illegale Handel die treibende Kraft hinter ihrem dramatischen Rückgang. Es bleibt zu hoffen, dass die weltweite Gemeinschaft aus Politik, Naturschutz und Öffentlichkeit gemeinsam entschlossen handelt, damit die Natur nicht die Rechnung für politische Fehlentscheidungen bezahlt. Die Zukunft vieler ikonischer Tierarten hängt jetzt davon ab.