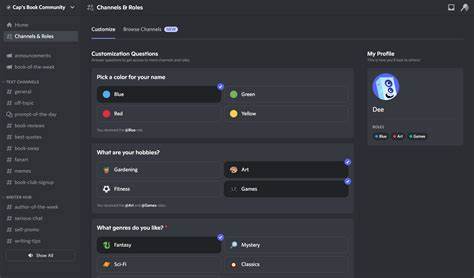Große Zukunftsentwürfe faszinieren und polarisieren zugleich. Von visionären Plänen, den Mars zu besiedeln, bis hin zu künstlicher Intelligenz, die als potenzieller Alleskönner der kommenden Jahrhunderte gilt, zeichnen sich utopische Bilder eines technologisch überformten Lebens in ferner Zukunft ab. Doch so ehrgeizig und mitreißend diese Vorstellungen auch sein mögen, ein nüchterner, skeptischer Blick zeigt viele fundamentale Schwächen und Problematiken auf. Die kritische Analyse dieser grandiosen Zukunftsentwürfe ist nicht nur wichtig, um unrealistische Hoffnungen zu dämpfen, sondern auch, um die ethischen Implikationen und technischen Grenzen zu verstehen, die oftmals unter den Teppich gekehrt werden. Die Debatte darüber wird aktuell in Adam Beckers Buch „More Everything Forever“ exemplarisch geführt.
Becker untersucht in seinem Werk die Zukunftsträume zahlreicher Technikpioniere und wie deren Überzeugungen und Ideologien unsere Wahrnehmung von Fortschritt und Zukunft prägen. Er stellt auch tiefgreifende Fragen zur Machbarkeit, den ethischen Dimensionen und den Risiken der sogenannten „großen Pläne“, die häufig von Silicon Valley-Eliten und Zukunftsdenkern befeuert werden. Eine der markantesten Visionen ist die Kolonisierung des Mars. Diese Idee ist stark von Persönlichkeiten wie Elon Musk geprägt, der nicht nur humorvoll, sondern mit ernsthaftem Engagement daran arbeitet, den roten Planeten zu einem zweiten Zuhause der Menschheit zu machen. Musk träumt von einer millionenköpfigen Bevölkerung auf dem Mars bis 2050 als eine Art Versicherung gegen eine Erderwärmung oder andere apokalyptische Katastrophen, die die Erde unbewohnbar machen könnten.
Auch andere Milliardäre wie Jeff Bezos und Marc Andreessen setzen große Hoffnungen in Weltraumstädte und Bevölkerungswachstum im Weltall. Während diese Visionen großartig klingen, entlarvt die kritische Analyse von Becker diese Zukunftspläne als hochgradig unrealistisch und moralisch fragwürdig. Mars ist ein lebensfeindlicher Planet mit extremen Herausforderungen: hohe Strahlenbelastung, geringe Gravitation, keine Atmosphäre zum Atmen und giftiger Boden. Im Vergleich zu den Extremen der Antarktis ist Mars noch feindseliger. Deshalb ist es abzusehen, dass niemand dort wirklich dauerhaft leben, Familien gründen oder Gemeinschaften aufbauen wird.
Die Distanzen zu anderen Sternensystemen sind so enorm, dass interstellare Reisen in absehbarer Zukunft unmöglich bleiben. Die Skepsis richtet sich nicht nur gegen die Machbarkeit der Weltraumkolonien, sondern auch gegen die grundlegenden Annahmen vieler Zukunftsforscher. So hinterfragt Becker das Phänomen des exponentiellen Wachstums und die damit verbundene Vorstellung, dass technologische und gesellschaftliche Entwicklung unbegrenzt sein könnten. Das ikonische Beispiel von Ray Kurzweil und seiner Beschreibung von sich verdoppelnden Lily Pads, die irgendwann einen Teich vollständig bedecken, fungiert als treffende Metapher. Wachstum in einem begrenzten System ist zwangsläufig endlich, weil Ressourcen nie unendlich sind.
Die Realität physikalischer Grenzen, wie etwa die begrenzte Rechenleistung zwischen den heute geltenden Grenzen von Moore’s Law, macht die Annahme eines unaufhörlich exponentiellen Fortschritts fragwürdig. Der Gründer von Moore’s Law selbst hatte bereits vor Jahren prognostiziert, dass das exponentielle Wachstum in der Chipentwicklung bald an seine Grenzen stoßen würde, was mittlerweile erkennbar ist. Kernkritisch setzt sich Becker auch mit Ideologien auseinander, die hinter vielen Zukunftsentwürfen stehen, etwa dem sogenannten Longtermismus. Dieser Ansatz priorisiert das Wohlergehen von Milliarden oder gar Billionen von zukünftigen Menschen über die Bedürfnisse der heutigen Generation. Die Logik ist, dass zukünftige Menschen in noch viel größerer Zahl existieren werden und deshalb unsere heutigen Entscheidungen vor allem ihrem Wohl dienen sollten.
Ein ethisch spannender und zugleich kontroverser Gedanke, der aber laut Becker auf unsicherem Terrain fußt. Wer wirklich weiß, wie die Bedingungen in einigen Jahrhunderten oder Jahrtausenden aussehen werden? Kann man die Gegenwart so einfach zugunsten von hypothetischen Menschen in einer weit entfernten Zukunft gestalten, ohne die heutige Generation zu belasten? Zudem zeigt sich an Beispielen in der philosophischen und rationalistischen Community, dass diese Ideen mitunter problematische, manchmal gar rassistische Denkweisen fördern. Einige Vertreter der Rationalisten unterstützen Konzepte wie „human biodiversity“, die genetisch determinierte Unterschiede zwischen Bevölkerungsgruppen behaupten — ein Pseudowissenschaftlich getarnter Ausdruck für weiße Vorherrschaft, den Becker deutlich ablehnt. Ähnlich kritisch sieht Becker die technische Faszination mit künstlicher Intelligenz. Während viele Zukunftsforscher Angst vor einer Superintelligenz haben, die der Menschheit entgleitet und potenziell zur Bedrohung wird, gibt es auch Stimmen aus der Fachwelt, die diese Sorge als übertrieben betrachten.
Namen wie Jaron Lanier, Melanie Mitchell und Yann LeCun treten für eine realistischere Einschätzung ein, die die Risiken nicht herunterspielt, aber auch nicht mythisch überhöht. Beckers Fazit ist ein Plädoyer für mehr Sachlichkeit: Eine AI-Übernahme der Welt ist nicht unausweichlich, aber die Fokussierung auf Intelligenz als alleiniges Ziel der Forschung kann zu Blindheiten führen. Die KI-Forschung muss ethisch reflektiert und gesellschaftlich eingebettet werden, um Gefahren wie etwa Diskriminierung, Überwachung oder ökonomische Ungleichheiten zu vermeiden. Ein weiteres zentrales Thema Beckers ist die Frage der Verantwortung für unseren Planeten. Warum liegt der Fokus vieler Tech-Milliardäre so stark auf Fluchtplänen ins All, während der Zustand der Erde und ihre dringenden Probleme wie Klimawandel, Artensterben und Umweltzerstörung oft weniger Beachtung finden? Becker zitiert die Astronomin Lucianne Walkowicz, die hier eine Art „Get Out of Jail Free“-Karte sieht, mit der Einladung, Verantwortung abzuschieben, indem man sich eine Option auf Flucht offen hält.
Diese Haltung könnte ein gefährlicher Ausdruck von Resignation oder gar Selbstüberschätzung sein: Statt die Erde zu heilen und Gesellschaften nachhaltiger zu gestalten, wird eine Zukunft jenseits von ihr mit übertriebenen Hoffnungen versehen. Nicht zuletzt wirft Becker einen kritischen Blick auf die Machtverhältnisse, die hinter vielen Zukunftsentwürfen stehen. Die Frage, wer überhaupt bestimmt, wie wir in Zukunft leben wollen, ist fundamental. Wenn eine Handvoll milliardenschwerer Technologen und Unternehmer die Richtung vorgibt, besteht die Gefahr, dass demokratische Prozesse und die Vielfalt gesellschaftlicher Interessen unter die Räder kommen. Der Ruf nach mehr Mitsprache für die breite Öffentlichkeit, mehr Transparenz und ethische Standards in der Technologieentwicklung steckt in vielen Teilen seines Buches.
Zukunft ist kein exklusives Terrain der Eliten, sondern ein gemeinschaftliches Projekt, das Verantwortung und Teilhabe aller Menschen erfordert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die großen Zukunftsentwürfe faszinierende Visionen liefern, denen jedoch ein gesundes Maß an Skepsis gut steht. Nicht jede utopische Vorstellung ist realistisch, nicht jede technologische Innovation wird unser Leben automatisch zum Besseren wenden. Die Grundannahmen vieler Zukunftsmodelle wie das unendliche Wachstum, die Flucht ins All oder ein allmächtiges AI-Zeitalter sind mit erheblichen wissenschaftlichen, ethischen und philosophischen Zweifeln behaftet. Statt die Realität zu idealisieren oder Ängste vor einer düsteren Zukunft zu schüren, fordert der skeptische Blick zur Besinnung auf unsere tatsächlichen Herausforderungen auf: Die Erde ist unser einziges Zuhause, und sie bedarf unserer Fürsorge und Verantwortung.
Nur wenn wir teils unbequem, teils kritisch hinterfragen, wohin wir im Rausch technologischer Fortschritte steuern, können wir eine Zukunft gestalten, die nicht auf Illusionen basiert, sondern auf realistischen, inklusiven und nachhaltigen Grundlagen. Die Zukunftsvisionen mögen große Geschichten erzählen – am Ende aber ist es der Bezug zur Gegenwart und die Verantwortung für unseren Planeten und die Gemeinschaft der Menschen, die zählen. Denn wie Becker eindrücklich formuliert: Wir werden die Erde nicht hinter uns lassen, doch wir leben bereits unter den Sternen.







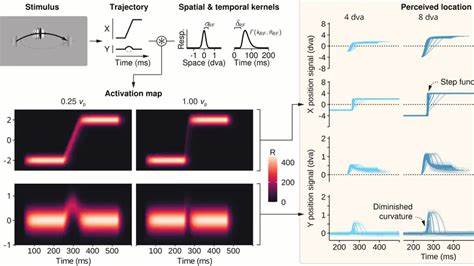
![Why are Truffles so expensive? Are they worth it? [video]](/images/03E0DFF8-B003-477F-BF1F-148D589E22CA)