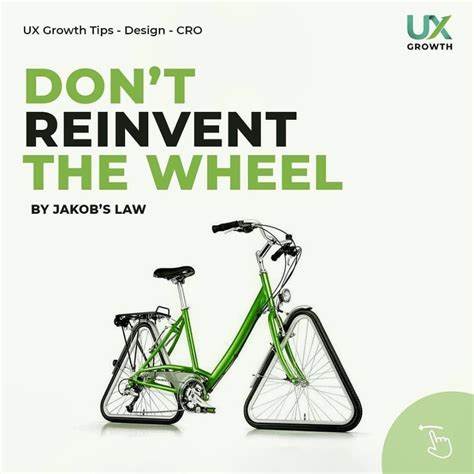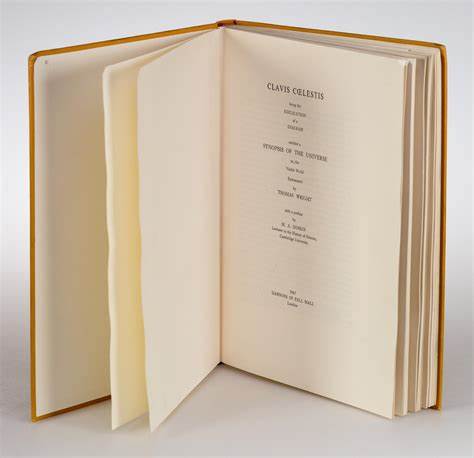Die Nordsee hat sich in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Schauplätze für erneuerbare Energien entwickelt. Mit dem stetigen Ausbau von Offshore-Windparks wollen viele Länder, darunter Großbritannien, Deutschland und die Niederlande, ihre Energieversorgung nachhaltiger gestalten und ihre Klimaziele erreichen. Doch mit der immer dichter werdenden Bebauung der Nordsee durch Windparks treten auch neue Probleme zu Tage, die weit über den eigentlichen Betrieb der Anlagen hinausgehen. Inmitten des Kampfes um umweltfreundliche Energie ist ein neues Phänomen entstanden, das die Branche vor große Herausforderungen stellt: der sogenannte „Wake-Effekt“ oder umgangssprachlich auch „Winddiebstahl“ genannt. Dieses Problem führt zu erbitterten Auseinandersetzungen zwischen Windparkbetreibern und könnte die Entwicklung der Offshore-Windindustrie in der Nordsee erheblich beeinträchtigen.
Der Wake-Effekt beschreibt das Phänomen, dass eine Windkraftanlage den Wind, der auf sie trifft, verlangsamt und in ihrer Nachbarschaft eine Windabdämpfung verursacht. Dadurch steht den Windrädern, welche auf der sogenannten „downstream“-Seite, also in Windrichtung hinter dem ersten Park angeordnet sind, weniger Windenergie zur Verfügung. Die Folge ist eine reduzierte Energieausbeute dieser Anlagen. Dieses technische Problem ist nicht neu, wurde bisher allerdings nur als marginale Schwäche betrachtet. Mit dem Wachstum der Windparks und dem Bau immer größerer Turbinen hat die Wirkung des Wake-Effekts jedoch an Bedeutung gewonnen.
Moderne Turbinen erreichen heute Höhen von über 360 Metern – mehr als das höchtste Gebäude in London, der Shard. Solche Giganten erzeugen neben dem maximalen Ertrag auch eine längere Windschattenzone, die sich bis zu 60 Kilometer weit hinter einem Windpark erstrecken kann. Dadurch wird die sogenannte Nachlaufinfluenzzone deutlich größer, was bedeutet, dass neue Windparks, die in der Nähe bereits bestehender Anlagen entstehen, zwangsläufig den Wind der Vorgänger „absaugen“ und damit deren Erträge mindern. Diese Entwicklung hat zu einem regelrechten Wettstreit um die besten Standorte und die optimalen Positionen der Anlagen in der Nordsee geführt. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Wake-Effekts sind für die Betreiber der Windparks erheblich.
Auch wenn die prozentuale Einbuße an Ertrag vergleichsweise gering anmutet – typischerweise zwischen vier und fünf Prozent –, summiert sich dies über die geplante Lebensdauer der Projekte zu einem erheblichen finanziellen Verlust. Für Unternehmen wie Ørsted, RWE, Equinor, Total oder Scottish Power stehen dadurch potenziell hunderte Millionen Pfund auf dem Spiel. So gab es bereits Streitfälle, bei denen bestehende Betreiber befürchteten, dass neue Projekte in angrenzenden Arealen ihre Einnahmen um mehrere hundert Millionen Pfund reduzieren könnten. Die „Windkriege“ entfalten sich nicht nur innerhalb einzelner Länder, sondern auch auf europäischer Ebene. Die Nordsee wird von mehreren Nationen genutzt, deren Windparks oft in unmittelbarer Nähe zueinander liegen.
Belgien wurde beispielsweise vorgeworfen, den Wind für die niederländischen Anlagen zu „stehlen“, während die Niederlande selbst wiederum im Konflikt mit Deutschland stehen. Diese grenzüberschreitenden Herausforderungen verschärfen die Situation zusätzlich und machen eine koordinierte Lösung unerlässlich. Angesichts der wachsenden Bedeutung der Offshore-Windenergie für die Energiewende ist der britische Energieminister Ed Miliband auf das Problem aufmerksam geworden. Um die Streitigkeiten zu entschärfen und Planungssicherheit für die Branche zu schaffen, hat die britische Regierung eine umfassende Studie an der Universität Manchester in Auftrag gegeben. Ziel dieser Untersuchung ist es, valide und verlässliche Modelle zu entwickeln, mit denen sich die Auswirkungen des Wake-Effekts genau quantifizieren lassen.
Eine solche Methodik soll dabei helfen, Konflikte vor der Genehmigung von Windparkprojekten besser beurteilen und gegebenenfalls verhindern zu können. Bislang wurden die meisten dieser Konflikte im Rahmen des britischen Planungsrechts von der Planungsbehörde ad hoc entschieden, ohne dass es eine einheitliche, verbindliche Regelung gibt. Die instabile Rechtslage schafft Unsicherheiten, die Investoren abschrecken können und somit das Wachstum der Offshore-Windindustrie hemmen. Das Ziel der Regierung ist es, klare und verbindliche Leitlinien zur Gestaltung von Pufferzonen zwischen einzelnen Windparks zu entwickeln, die den Wake-Effekt minimieren. Es ist wahrscheinlich, dass dies auch zu Änderungen in der Planungspraxis führen wird, etwa durch größere Abstände zwischen Windparks oder durch die Anpassung der Turbinengrößen und -positionen.
Darüber hinaus wird in der Branche zunehmend über ein mögliches Entschädigungssystem für Betreiber diskutiert, die durch den Wake-Effekt erhebliche Einbußen erleiden. Eine gerechte Vergütung könnte beispielsweise an die Höhe der gemessenen Leistungseinbußen gekoppelt werden. Allerdings ist eine solche Kompensation noch Zukunftsmusik und bedarf einer politischen und rechtlichen Klärung, da die Bestimmung von Verantwortlichkeiten bei dieser komplexen meteorologischen Wechselwirkung nicht trivial ist. Technisch gesehen ist der Wake-Effekt ein komplexes Zusammenspiel aus Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Turbinengröße, Abstand zwischen den Anlagen und weiteren atmosphärischen Bedingungen. Die vorherrschende Windrichtung in der Nordsee ist meist aus südwestlicher Richtung, doch Windverhältnisse ändern sich im Tagesverlauf dynamisch.
Deshalb ist es besonders schwierig, feste Modelle zu etablieren, die den Einfluss des Wake-Effekts auf den Ertrag über das gesamte Jahr zuverlässig vorhersagen können. Zudem versuchen Windparks, ihre Anordnung und die Betriebsweise so zu optimieren, dass interne Wake-Verluste minimiert werden. Das heißt aber nicht, dass zwischen verschiedenen Windparks die Verluste vollständig vermeidbar sind. Vor dem Hintergrund von Ed Milibands ambitioniertem Ziel, die Offshore-Windkapazität Großbritanniens bis 2030 auf 50 Gigawatt zu mehr als verdreifachen, bedeutet das Wake-Effekt-Dilemma ein erhebliches Risiko. Derzeit gibt es etwa 15 Gigawatt installierte Leistung, doch in den Planungen befinden sich weitere 77 Gigawatt.
Sobald diese vielen Projekte realisiert sind, wird die Nordsee enorm verdichtet sein, und der Wettbewerb um die knappen Windressourcen wird weiter zunehmen. Die Industrie steht somit vor einer entscheidenden Phase. Ein geordneter Rahmen, der diese Konflikte frühzeitig adressiert und auflöst, ist essenziell für den Erfolg der Energiewende im Offshore-Bereich. Gleichzeitig könnte die Zusammenarbeit zwischen den Ländern, die die Nordsee gemeinsam nutzen, zu einer harmonisierten Entwicklung der Windenergie führen. Forscher, Politiker und Unternehmen arbeiten derzeit daran, tragfähige Lösungen zu finden, die sowohl ökologisch sinnvoll als auch wirtschaftlich tragbar sind.