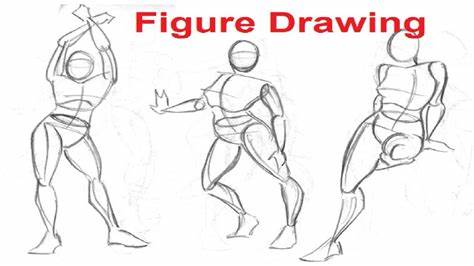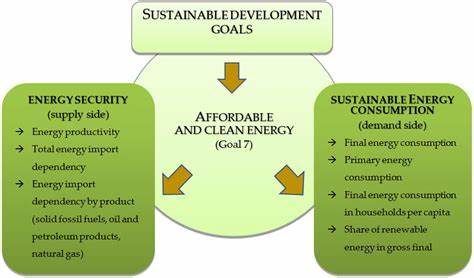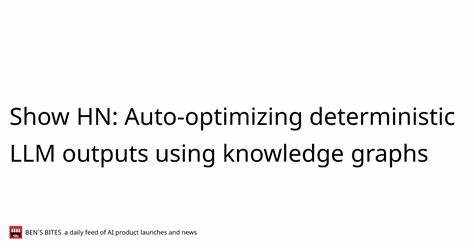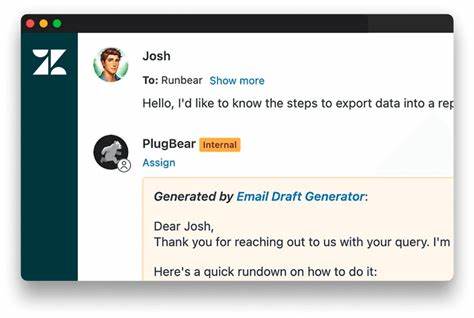In der heutigen digitalisierten Welt sind soziale Bewegungen und Aktivismus untrennbar mit dem Internet und insbesondere mit den Angeboten großer Technologieunternehmen verbunden. Plattformen wie Facebook, Twitter, Google sowie zahlreiche andere Dienste von Big Tech dominieren nicht nur die Art und Weise, wie Menschen kommunizieren und Informationen austauschen, sondern auch, wie Bewegungen organisiert, informiert und mobilisiert werden. Diese steigende Abhängigkeit birgt jedoch erhebliche Risiken, die zunehmend an Bedeutung gewinnen und neue Diskussionen über digitale Souveränität, Datenschutz und die Machtkonzentration in der digitalen Welt anstoßen. Die Bewegung „Cutting the Cord“ – im Sinne von „den Stecker ziehen“ – steht symbolisch für den Versuch, sich von der Dominanz der großen Technologieunternehmen zu lösen und alternative Wege zu suchen, um unabhängig und selbstbestimmt zu kommunizieren. Dieses Bestreben ist eng verbunden mit dem wachsenden Bewusstsein vieler Nutzer und Aktivisten für die Gefahren, die mit einer unkritischen Nutzung der Dienste von Big Tech einhergehen.
Dazu zählen neben der zentralisierten Datensammlung und Überwachung auch die Algorithmen, die Inhalte filtern beziehungsweise formen und damit die Meinungsbildung maßgeblich beeinflussen. Ein zentrales Problem besteht darin, dass soziale Bewegungen einerseits auf die Reichweite und Vernetzungspotenziale großer Plattformen angewiesen sind, sich andererseits jedoch gefährden, indem sie ihre Organisation, Kommunikation und Mobilisierung zu stark von diesen Diensten abhängig machen. Ein Ausfall, eine Zensur oder auch nur eine Änderung der Geschäftsbedingungen können dazu führen, dass ganze Bewegungen geschwächt oder sogar vollständig lahmgelegt werden. Zudem verlieren sie die Hoheit über ihre eigenen Daten, was langfristig auch die strategische Planung erschwert. Um dieser Abhängigkeit entgegenzuwirken, setzen immer mehr Initiativen auf dezentrale und offene Technologien.
So gewinnen dezentrale soziale Netzwerke wie Mastodon, Matrix oder Peer-to-Peer-Kommunikationslösungen zunehmend an Bedeutung. Diese Alternativen bieten Nutzerinnen und Nutzern mehr Kontrolle über ihre Daten und schaffen gleichzeitig neue Freiräume für nachhaltigen digitalen Aktivismus. Neben der Entwicklung und Verbreitung solcher Technologien ist es jedoch auch entscheidend, das Bewusstsein für digitale Selbstbestimmung zu schärfen. Nur wenn Aktivisten, Organisationen und Nutzer verstehen, warum und wie sie ihre digitale Präsenz absichern können, entsteht eine stabile Basis für unabhängigen Aktivismus. Darüber hinaus wird der Umgang mit großen Technologieanbietern zu einem strategischen Thema.
Bewegungen müssen sowohl die Chancen als auch die Risiken abwägen und eine ausgewogene Balance finden. Oftmals ist es sinnvoll, die vorhandenen Netzwerke mit strategischem Fingerspitzengefühl zu nutzen, ohne sich jedoch vollständig auf diese zu verlassen. Ein Ansatz besteht darin, wichtige Informationen und kritische Kommunikation parallel auf alternativen Plattformen verfügbar zu machen, um im Falle von Störungen oder Einschränkungen handlungsfähig zu bleiben. Ein wesentlicher Baustein der Unabhängigkeit ist zudem die Wahl der technischen Infrastruktur. Eigene Server, verschlüsselte Kommunikationswege und Open-Source-Software ermöglichen einen starken Schutz vor ungewollter Überwachung und Manipulation.
Die Verbindung zwischen technologischer Unabhängigkeit und politischer Selbstbestimmung wird somit immer offensichtlicher. Gleichzeitig gilt es, den technischen Zugang und die Bedienfreundlichkeit alternativer Lösungen so zu gestalten, dass sie für eine breite Masse an Nutzerinnen und Nutzern attraktiv und zugänglich sind. Die Abhängigkeit von Big Tech stellt auch eine demokratische und gesellschaftliche Herausforderung dar. Denn durch die Konzentration von Macht, Daten und Einfluss in wenigen Händen können demokratische Prozesse verzerrt werden. Die mediale Öffentlichkeit und Diskurse werden auf bestimmte Algorithmen und Plattformen konzentriert, die ihre eigenen Interessen verfolgen und nicht zwangsläufig die Vielfalt der gesellschaftlichen Meinungen abbilden.
Die digitale Öffentlichkeit darf nicht auf proprietäre Systeme reduziert werden, die zugleich wirtschaftlichen Gewinn maximieren und Meinungsvielfalt einschränken. Ein weiteres Problem sind immer wiederkehrende Datenschutzskandale und der Missbrauch von persönlichen Daten. Bewegungen, die auf Basis von Vertrauen und Transparenz arbeiten, können sich diesen Herausforderungen nur schwer entziehen. Die Gefahr, dass sensible Daten in die falschen Hände geraten oder für Überwachungszwecke genutzt werden, schränkt das Engagement vieler Menschen ein und kann zu einem Verlust von Glaubwürdigkeit führen. Insgesamt zeigt sich, dass der Weg zu einer nachhaltigen und unabhängigen digitalen Bewegungsarbeit komplex ist.
Es reicht nicht, nur einzelne technische Lösungen zu etablieren. Vielmehr ist eine ganzheitliche Strategie gefragt, die technologische, organisatorische und gesellschaftliche Aspekte vereint. Bildung über digitale Chancen und Risiken, Förderung von dezentralen Infrastrukturen sowie politische Maßnahmen zur Regulierung von Big Tech gehören dazu. Abschließend lässt sich sagen, dass die Bewegung „Cutting the Cord“ ein Ausdruck eines fundamentalen Wandels im Umgang mit digitaler Technologie ist. Sie spiegelt das Bedürfnis nach Kontrolle, Sicherheit und Unabhängigkeit wieder – Werte, die für die Zukunft digitalen Aktivismus multidimensional bedeutsam sind.
Die Herausforderung besteht darin, den Spagat zwischen der Nutzung der unverzichtbaren Reichweiten der großen Plattformen und der Schaffung eines resilienten, fairen und eigenständigen digitalen Ökosystems zu meistern. Nur so kann der gesellschaftliche und politische Einfluss von Bewegungen langfristig gesichert und gestärkt werden.
![Cutting the Cord: Addressing the movement's dependence on Big Tech [pdf]](/images/88D01BCF-D1A1-436B-85E2-C2D57F426DCB)