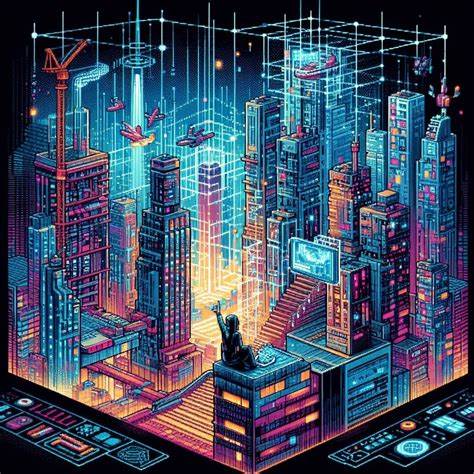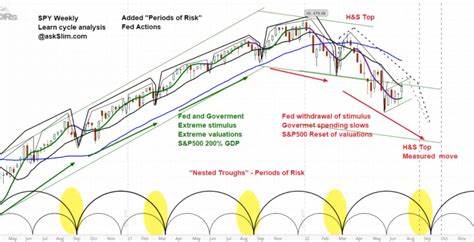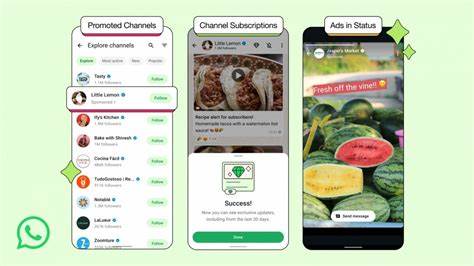Die digitale Transformation hat die Art und Weise, wie Unternehmen mit Daten umgehen, grundlegend verändert. Insbesondere das Data Streaming hat sich zu einem zentralen Bestandteil moderner Dateninfrastrukturen entwickelt, denn es ermöglicht die Echtzeitverarbeitung und Analyse von Datenströmen aus unterschiedlichsten Quellen. Doch trotz der enormen Potenziale steht diese Technologie vor erheblichen Herausforderungen, die es zu überwinden gilt, um in Zukunft noch effizienter, nutzerfreundlicher und skalierbarer zu werden. Der Kontext von Data Streaming ist von grundlegender Bedeutung. Anders als die klassische Batch-Verarbeitung, bei der Daten in großen Blöcken zeitversetzt ausgewertet werden, erlaubt Streaming kontinuierliche Datenverarbeitung in Echtzeit.
Dies eröffnet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten – von der sofortigen Reaktion auf Kundeninteraktionen bis hin zum Monitoring vernetzter Geräte im Internet der Dinge (IoT). Gleichzeitig ist die Streaming-Technologie jedoch mit einer gewissen Komplexität verbunden, was nicht zuletzt an der Vielzahl der dafür nötigen Komponenten liegt. Im aktuellen Stand der Technik ist zur Realisierung eines einfachen Stream-Verarbeitungsprozesses oft eine komplexe Infrastruktur erforderlich, die verschiedene Technologien miteinander verknüpft. Software wie Debezium sorgt für Change Data Capture, Avro Registry für das Schema-Management, Kafka für die Verwaltung der Datenströme, Flink als Stream-Processing-Engine und JDBC-Sinks zur Beschickung von Zielsystemen wie Datenbanken. Schon alleine das Verstehen und Konfigurieren dieser Komponenten erfordert tiefgehendes Know-how, welches den Einstieg für Unternehmensanwender erschwert.
Besonders die enge Kopplung von Streaming-Systemen an andere Datenprodukte stellt ein wesentliches Hindernis dar. Streamprozessoren sind selten allein lauffähig, da sie auf externe Systeme angewiesen sind, um die verarbeiteten Daten letztlich zu speichern, zu indexieren und für Analyse- oder Anwendungen nutzbar zu machen. Ein Stream-Verarbeitungssystem ohne Anschluss an eine persistente Datenbank ist vergleichbar mit einer E-Mail ohne Posteingang. Das Zusammenspiel der unterschiedlichen Systeme bedingt eine hohe Kompatibilität und führt bei kleinen Fehlern in einer Komponente häufig zu Störungen im gesamten Ablauf. Darüber hinaus ist die Streaming-Verarbeitung technisch anspruchsvoller als die Batch-Verarbeitung, weil sie gleichzeitig mit aktuellen und künftigen Daten umgehen muss.
Während Batch-Systeme lediglich vorhandene Daten verarbeiten, müssen Stream-Prozessoren auch für zukünftige Datenänderungen vorbereitet sein. Dieses Mehr an Komplexität zeigt sich vor allem bei Operationen wie Joins, bei denen in Streaming-Umgebungen deutlich aufwändigere Strukturen gepflegt werden müssen, um alle möglichen Datenflussvarianten abzudecken. Nicht zuletzt erfordert die Gewährleistung von Reihenfolgen und Konsistenz in Echtzeit eine ausgefeilte Verarbeitung, die etwa sicherstellt, dass bei der Verarbeitung parallel ein- und ausgehender Daten keine Widersprüche entstehen. Solche Anforderungen stellen hohe Ansprüche an Parallelisierung und Fehlertoleranz und sind ein Grund, warum Streaming-Systeme auch bei erfahrenen Dateningenieuren als komplex gelten. Trotz dieser Herausforderungen hat die Streaming-Technologie in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte gemacht.
Die ursprüngliche Idee von Jay Kreps, Kafka als vielseitiges, modulares System zu entwerfen, hat zu einer ungebundenen Infrastruktur geführt, bei der viele spezialisierte Tools zusammenspielen. Diese Aufteilung in einzelne, spezialisierte Bausteine hat zwar die technische Leistungsfähigkeit erhöht, jedoch auf Kosten einer erhöhten Komplexität für den Anwender. Individualität bei Komponenten und Konfigurationen macht es notwendig, sich tief in die Implementierungsdetails einzuarbeiten – ein Zustand, der oft als Hemmschuh für breitere Adoption gesehen wird. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung zeichnet sich ein neuer Trend ab: die Entstehung einer neuen Generation von Stream-Prozessoren, die sich deutlich stärker an den Bedürfnissen der Nutzer orientieren. Diese Systeme behalten die ausgereiften technischen Fähigkeiten ihrer Vorgängergeneration bei, richten sich jedoch darauf aus, Komplexität zu abstrahieren und Transparenz zu schaffen.
Die Parallele lässt sich gut mit dem Wandel im Bereich der Datenbanken ziehen, bei dem komplexe, teils schwer handhabbare Enterprise-Lösungen wie Oracle von benutzerfreundlicheren Systemen wie PostgreSQL abgelöst wurden. Um diese neue Generation von Streaming-Systemen überhaupt möglich zu machen, mussten die alten Ansätze des „Zusammenklebens“ verschiedener generischer Komponenten durch ein ganzheitliches, integriertes Design ersetzt werden. Neue Algorithmen und Technologien, die beispielsweise aus dem Bereich des differenziellen Datenflusses (differential dataflow) und der Transaction-Replication (wie bei PeerDB oder Fivetran) stammen, bilden die technologische Basis dieser Entwicklung. Ein wichtiger Aspekt ist hier, dass alle internen Komponenten konsequent auf die Einhaltung von Datenbanktransaktionen ausgerichtet sind – was für einen Nutzer eine erhebliche Vereinfachung bei der Gewährleistung von Ordnung und Konsistenz bedeutet. Ein Stream-Prozessor der neuen Generation ist fähig, die komplette Pipeline aus Datenaufnahme, -transformation und -ausgabe über eine einzige, einfache Benutzeroberfläche zu steuern.
Prozesse wie Parallelisierung, Fehlertoleranz und Schemaentwicklung werden automatisch gehandhabt, ohne dass der Nutzer sich intensiv mit diesen operativen Details beschäftigen muss. Damit sinkt die Eintrittsbarriere für Unternehmen, die Streaming-Technologien einsetzen wollen, enorm. Gleichzeitig eröffnen sich durch die Echtzeitverarbeitung völlig neue Geschäftsmodelle und Anwendungsfälle. Die Auswirkungen einer einfach zu handhabenden, skalierbaren Streaming-Technologie wären weitreichend. Komplexe Abfragen könnten nicht mehr pulverisiert und verzögert, sondern beständig aktuell gehalten werden.
Datenverschiebungen zwischen unterschiedlichen Speichersystemen könnten automatisiert und effizient gelöst werden, und bestehende ETL- sowie Datenmodellierungsprozesse könnten inkrementell und quasi in Echtzeit erfolgen. Auch für Endanwender würde sich das Nutzererlebnis verbessern, da Frontends unmittelbar auf Datenaktualisierungen reagieren können. Die Kosten und der Aufwand in der Dateninfrastruktur könnten dadurch erheblich reduziert werden, während Entwickler und Ingenieure mehr Kapazität hätten, sich auf die Entwicklung wertschöpfender Anwendungslogiken zu konzentrieren. Diese Aussicht macht die weitere Entwicklung und Adoption moderner Stream-Prozessoren zu einem spannenden und wichtigen Thema für die Datenbranche. Ebenso spannend ist die mögliche Demokratisierung von Streaming-Technologien.
Bislang wurden diese hauptsächlich von großen Technologieunternehmen mit entsprechendem Fachwissen verwendet. Mit der nächsten Generation von Stream-Prozessoren könnte die leistungsstarke Echtzeitdatenverarbeitung auch für mittelständische Unternehmen und Startups zugänglicher und attraktiver werden, was neue Innovationswellen befeuern wird. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Data Streaming trotz seiner inhärenten Komplexität eine bedeutende Zukunft vorausgesagt wird. Die technologische Evolution führt zu Systemen, die zwar intern komplex sind, aber dem Anwender diese Komplexität auf intelligente Weise abnehmen. Dadurch wird es möglich, Realzeit-Datenverarbeitung nahezu so einfach handhabbar zu machen wie klassische Batch-Prozesse – mit allen Vorteilen, die das für moderne Unternehmen und Anwendungen mit sich bringt.
Die nächsten Jahre werden zeigen, wie schnell und umfassend sich diese neuen Technologien in der Praxis durchsetzen werden. Doch bereits jetzt ist klar: Wer den Sprung zu nutzerfreundlichen, robusten und skalierbaren Stream-Prozessoren schafft, gestaltet maßgeblich die Zukunft der datengetriebenen Innovation mit.