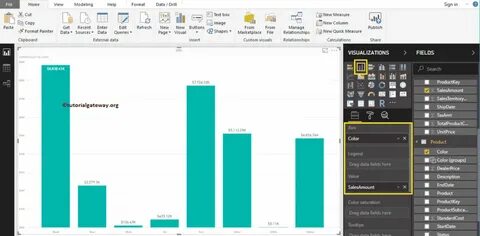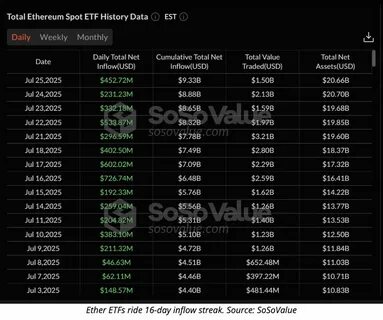In der heutigen datengetriebenen Welt stehen Unternehmen und Analysten vor der Herausforderung, große Datenmengen möglichst schnell und effizient auszuwerten. Dashboards spielen eine zentrale Rolle bei der Visualisierung und der Echtzeitübersicht dieser Daten. Doch die Performance eines Dashboards hängt nicht nur von der zugrunde liegenden Hardware ab, sondern auch von der Art und Weise, wie Daten gespeichert, sortiert und abgefragt werden. Hier setzt die innovative Technik der multi-spalten-approximativen Sortierung an, die insbesondere bei Nutzung von spaltenbasierten Datenformaten wie DuckDB oder Parquet entscheidende Vorteile bietet. Traditionell erfolgt die Sortierung von Daten häufig nach einem oder wenigen vordefinierten Spalten.
Diese Praxis führt in vielen Gebrauchsszenarien zu suboptimalen Ergebnissen, da Abfragen in Dashboards oft unterschiedliche Filterkombinationen und Bedingungen aufweisen. Beispielsweise könnte ein Benutzer Daten nicht nur anhand eines einzelnen Flughafencodes, sondern kombiniert mit Zielorten und Zeiträumen filtern. Wenn die Daten perfekt nach einer Spalte sortiert sind, aber bei weiteren Filtern kaum Sortierungseffekte genutzt werden können, leidet die Performance unter erhöhtem Datenvolumen, das gelesen und verarbeitet werden muss. Genau hier setzt die Approximate Sorting Strategie an: Statt exakter Sortierung nach wenigen Spalten wird eine annähernde Sortierung über mehrere Spalten hinweg realisiert. Dies ermöglicht den sogenannten Zone Maps oder Min-Max-Indexierungen des DuckDB-Systems, auch bei komplexen Filterbedingungen deutlich effiziente Speicherzugriffe durchzuführen.
Zwei Hauptansätze bilden die Basis dieser Strategie – der Einsatz raumfüllender Kurven und die Sortierung anhand getrunktierter Zeitstempel. Raumfüllende Kurven wie die Morton- oder Hilbert-Kodierung finden ursprünglich Anwendung in der Geodatenanalyse. Dort sind sie dafür bekannt, zweidimensionale Koordinaten so in eine eindimensionale Ordnung zu überführen, dass nahe beieinander liegende Objekte auch nahe im Datenindex liegen. Übertragen auf mehrdimensionale Daten ermöglicht die Hilbert-Kodierung eine annähernde Sortierung von Datensätzen, deren Werte in mehreren Spalten kombiniert ausgewertet werden. Konkret bedeutet das: Beim Funktionsaufruf werden beispielsweise geografische Koordinaten in Integer-Darstellungen konvertiert, anschließend mit Hilfe der Hilbert-Kurve zu einem individuellen Sortierschlüssel zusammengefasst.
Ein anschauliches Beispiel hierfür ist die Suche nach Cafés in einem rechteckigen Gebiet. Durch die Hilbert-Sortierung liegen Cafés mit ähnlichen Breiten- und Längengraden nahe beieinander im Index, sodass Anfragen gezielt geleitete Datenzugriffe ausführen können. In der Praxis wird diese Technik jedoch nicht nur auf Geo-Koordinaten begrenzt. Auch alphanumerische Daten kann man mittels SQL-Makros vorverarbeiten: Hierbei werden die ersten Zeichen eines Strings in numerische Werte umgewandelt, die dann als Eingabe für die Kodierung dienen. Parallel dazu spielt die Behandlung von Zeitstempeln eine entscheidende Rolle.
Analyse-Dashboards enthalten häufig Zeitfilter, da aktuelle beziehungsweise neuere Daten besonders relevant sind. Hierbei reicht es jedoch nicht aus, die Daten einfach nach dem exakten Zeitstempel zu sortieren. Zeitstempel sind oft sehr granular, was bedeutet, dass praktisch nur sehr wenige Datensätze exakt den gleichen Zeitwert besitzen. Dies minimiert den Nutzen von Sortierung für diskrete Abfragen und erschwert Datenpruning bei zeitbasierten Filtern. Die Lösung liegt in der Trunkierung von Zeitstempeln.
Je nach Anwendungsfall werden Zeitstempel auf Tage, Wochen, Monate oder gar Jahre gerundet. Indem zuerst nach dem gerundeten Zeitwert und anschließend nach den weiteren Dimensionen sortiert wird, können Abfragen deutlich effizienter von einer besseren Sortierung profitieren. So lassen sich ganze Datenblöcke überspringen, deren Zeitfenster außerhalb des Abfragebereichs liegt. Ein praxisnahes Szenario veranschaulicht die Wirkung dieser Methoden: Die Analyse von US-Inlandsflügen mit einem umfangreichen Dataset von fünf Jahren. Dieses Dataset enthält Flughafencodes für Start- und Zielflughäfen, Flugzeiten und weitere Informationen.
Beim Betrieb des Dashboards auf einer Cloud-Datei, etwa auf S3, verbessert sich die Abfrageperformance durch diese Sortierarten vielfach spürbar. Insbesondere variierende Filterkombinationen auf Start, Ziel und Zeit gewinnen von der balancierten Sortierung über Morton- und Hilbert-Kodierungen sowie Zeitstempeltrunkierung. Im Rahmen von Benchmarks wurde eine Vielzahl von Sortierstrategien miteinander verglichen. Neben einer Zufallssortierung wurde zuerst nach einzelnen Spalten wie Startflughafen sortiert, anschließend nach Kombinationen von Start und Ziel. In den experimentellen Ansätzen wurden dann neuartige Reihenfolgen wie das abwechselnde Sortieren von einzelnen Buchstaben der Flughafencodes (zipped_varchar), sowie die Morton- und Hilbert-Kodierungen betrachtet.
Die Ergebnisse zeigten, dass gerade Hilbert-Sortierung eine konsistente Leistungssteigerung für unterschiedliche Filterfälle gewährleistet und somit als Favorit hervorgeht. Dabei zeigte sich, dass beim Filtern nach nur einem Kriterium die klassische Sortierung nach genau dieser Spalte punktet. Doch sobald weitere Dimensionen ins Spiel kommen – wie etwa Start- und Ziel in Kombination oder Zeitfilter – entfalten die approximativen mehrdimensionalen Sortierverfahren ihre Vorteile. Besonders bei Filtern, die sowohl zeitliche als auch andere Kriterien umfassen, ermöglicht die Kombination aus Zeitstempeltrunkierung und Hilbert-Kodierung eine erhebliche Reduktion der zu lesenden Datenmenge, was die Antwortzeiten auf Sekundenbruchteile verkürzt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Kompromiss zwischen der Einfügegeschwindigkeit und der Lesegeschwindigkeit.
Das Aufbereiten und Sortieren der Daten benötigt zwar initial mehr Zeit – in den untersuchten Fällen ungefähr eine Verdopplung bis Verdreifachung der Ladezeit im Vergleich zum einfachen Datenimport. Dennoch ist es eine lohnende Investition, da Dashboards bei Nutzern vor allem durch schnelle Reaktionen der Benutzer-Interface-Komponenten überzeugen müssen. Die Ladezeit eines Dashboards wird maßgeblich von der Geschwindigkeit der Datenabfrage mitbestimmt und nicht von der Datenaufbereitung im Hintergrund. Zur Bewertung der Effektivität verschiedener Sortierschemata wurde die Metrik „Anzahl der Row-Gruppen pro Wert“ zu Rate gezogen. Dabei wird untersucht, wie stark einzelne Werte einer Spalte über das Dataset verteilt sind.
Eine größere Konzentration auf wenige Row-Gruppen verbessert die Möglichkeit, Daten selektiv und effizient abzurufen. Sortierungen wie Hilbert erreichen dabei eine ausgeglichene Verteilung, bei der weder Start- noch Zielcodes übermäßig fragmentiert in vielen einzelnen Gruppen auftauchen. Dadurch steigt die parallele Verarbeitbarkeit und somit die Gesamtperformance bei parallelen Abfragen. Neben den beschriebenen reinen Sortiertechniken sind diese Ansätze gut kombinierbar mit weiteren Optimierungen, wie dem Partitionieren der Daten in DuckLake-Umgebungen, der intelligenten Indexierung oder dem gezielten Einsatz von Spaltenkomprimierung. Diese Maßnahmen ergänzen und verstärken den Effekt effizienter Filter und ermöglichen skalierbare und responsive Dashboard-Anwendungen selbst bei wachsenden Datenmengen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Verwendung von multi-spalten-approximativer Sortierung in modernen analytischen Systemen eine wichtige Rolle spielt, um Latenzen zu reduzieren und interaktive Dashboards mit vielfältigen Filtermöglichkeiten performant zu unterstützen. Insbesondere die Kombination von raumfüllenden Kurven wie Hilbert oder Morton in Verbindung mit gerundeten Zeitstempeln erlaubt es, verschiedene Abfragepfade gleichzeitig zu optimieren. Für Unternehmen und Entwickler ist es daher ratsam, sich intensiver mit diesen Sortierverfahren auseinanderzusetzen und diese in bestehende Datenpipelines zu integrieren. Die erhöhte Ladezeit beim Datenimport sollte nicht als Nachteil verstanden werden, sondern als langfristige Investition in die Benutzerfreundlichkeit und Effizienz von Analyseanwendungen. Gerade in einem Umfeld mit wechselnden Benutzerabfragen und unvorhersehbaren Filterkombinationen sorgt die Balance zwischen Sortierpräzision und Datenzugriffsoptimierung für die besten Ergebnisse.
Abschließend sei noch betont, dass die Messung von Sortiergüte mit Metriken wie der Anzahl der Row-Gruppen pro Wert den Weg ebnet, verschiedene Ansätze im Vorfeld zu evaluieren, ohne stets aufwändige Benchmarks fahren zu müssen. Dies erleichtert es Unternehmen, die optimale Strategie für den eigenen Datenbestand zu identifizieren und zu implementieren. Die Zukunft datengetriebener Dashboards wird stark von Methoden geprägt sein, die genau diese Art von Vielseitigkeit und Leistung erlauben. Die multi-spalten-approximate Sortierung ist dabei ein zentraler Baustein, um dem stetig steigenden Anspruch an schnelle und flexible Datenanalysen gerecht zu werden und daraus wettbewerbsfähige Erkenntnisse zu gewinnen.