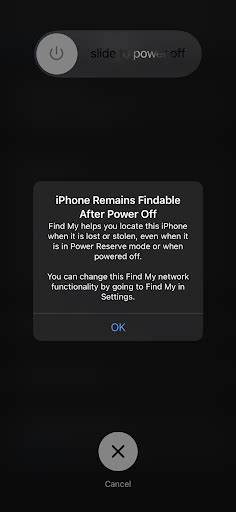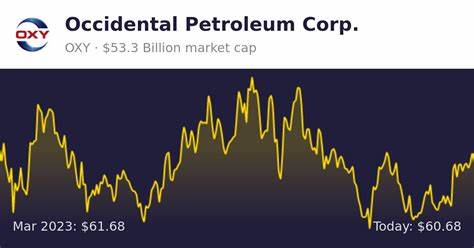Am Montag kam es auf der Iberischen Halbinsel zu einem außergewöhnlichen Ereignis: Ein massiver Stromausfall legte große Teile Spaniens und Portugals sowie angrenzende Gebiete in Frankreich lahm. Millionen Menschen waren betroffen, als plötzlich der vollständige Strom abgeschaltet wurde und Städte in Dunkelheit versanken. Die Wiederherstellung der Elektrizitätsversorgung innerhalb kurzer Zeit stellte für Ingenieure und Netzbetreiber eine gewaltige Herausforderung dar. Wie es den Experten gelang, die Lichter zurückzubringen, ist ein eindrucksvolles Beispiel für technische Präzision, sorgfältige Planung und kollektive Zusammenarbeit auf höchstem Niveau. Der Iberische Strommarkt ist einzigartig in Europa.
Spanien und Portugal sind geographisch relativ isoliert, da ihre Netze nur begrenzt mit dem Rest Europas verbunden sind. Diese Tatsache erhöht die Komplexität bei der Stabilisierung des Stromnetzes und schafft besondere Anforderungen an das Management und den Wiederaufbau nach einem Ausfall. Die Übertragungsnetze beider Länder verfügen über ein weit verzweigtes System aus Hochspannungsleitungen, Umspannwerken und Transformatoren, die konstant überwacht und justiert werden müssen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Am Tag des Ausfalls zeigten Messdaten der Europäischen Netz- und Informationssicherheitsagentur für Strom (ENTSO-e), dass die Spannung und Frequenz im Netz innerhalb kürzester Zeit stark abfielen. Dies führte zum völligen Kollaps.
Sofort reagierten die Systembetreiber, überwachten akribisch die Netzparameter und analysierten, wo die Störung ihren Ursprung hatte. In solchen Situationen spielt die Frequenzkontrolle eine zentrale Rolle, denn das Stromnetz funktioniert optimal bei einer Frequenz von 50 Hertz. Jede signifikante Abweichung kann die Stabilität des Systems gefährden. Die Rekonfiguration und das sogenannte Black-Start-Verfahren sind besonders sensibel. Ein Black-Start bedeutet, dass bestimmte Kraftwerke – in der Regel solche, die nicht auf das Netz angewiesen sind, um gestartet zu werden, wie Wasserkraftwerke oder kleinere Dieselgeneratoren – angefahren werden, um das Netz Schritt für Schritt wieder mit Strom zu versorgen.
Bei der Iberischen Halbinsel wurden insbesondere Wasserkraftwerke als „Starter“ eingesetzt. Diese Anlagen sind aufgrund ihrer Flexibilität und schnellen Anlaufzeit hervorragend geeignet, um zuerst lebenswichtige Einrichtungen wie Krankenhäuser und Verteidigungsanlagen zu versorgen. Anschließend musste die eingespeiste Energie behutsam erhöht und gleichzeitig mit der Verbrauchsmenge abgeglichen werden. Dies ist ein äußerst komplexer Prozess, denn jede Diskrepanz kann wiederum eine erneute Überlastung und nochmals einen Stromausfall auslösen. Die zuständigen Ingenieure arbeiteten eng zusammen, nutzten innovative Steuerungssysteme und Echtzeit-Datenanalysen, um die Balance zwischen Energieangebot und -nachfrage wiederherzustellen.
Portugal spielt in puncto erneuerbare Energien bereits eine Vorreiterrolle. Am Tag der Wiederinbetriebnahme stammten rund 77 Prozent des produzierten Stroms aus Wind- und Solarenergie, was die Stabilisierung zusätzlich erschwerte. Erneuerbare Energiequellen sind zwar umweltfreundlich und nachhaltig, bringen jedoch neue Herausforderungen bezüglich Schwankungen und Vorhersagbarkeit mit sich. Die Integration dieser volatilen Energieträger in ein tradtionell stabiles Netz erfordert neue Strategien, mehr Flexibilität und eine optimierte Koordination. Seit 2024 setzt Spanien vermehrt auf grüne Energie, mit über 50 Prozent des Strombedarfs, der aus erneuerbaren Quellen gedeckt wird.
Tatsächlich erreichte die iberische Region Mitte April 2025 sogar einen Anteil von nahezu 100 Prozent. Experten warnen, dass gerade Zeiten mit starker Sonneneinstrahlung oder Wind – wie während des Frühjahrs – zu Überproduktionen führen können. Um dem entgegenzuwirken, arbeiten Netzbetreiber eng länderübergreifend zusammen, um Lasten intelligent zu steuern und Stromflüsse dynamisch anzupassen. Das Ereignis auf der Iberischen Halbinsel dient zugleich als Weckruf für ganz Europa. Es verdeutlicht, wie wichtig ein belastbares, flexibles Stromnetz ist und wie essenziell die internationale Kooperation zwischen den Übertragungsnetzbetreibern ist.
Schon kleine Störungen können sich schnell auf weite Strecken auswirken. Wie ein Elektrikprofessor der Universität College Dublin erläuterte, spiegelt die plötzliche Flut von Alarmmeldungen den hohen Anspruch wider, den die Netzregulatoren täglich managen. Die Untersuchung der Ursachen dieses Stromausfalls läuft noch. Spanische und portugiesische Regierungschefs haben die Europäische Kommission ersucht, eine unabhängige Expertenkommission einzusetzen. Diese soll innerhalb von sechs Monaten einen umfassenden Bericht über Herkunft, Gründe und Verbesserungsvorschläge vorlegen.
Parallel wird auch ein rechtsmedizinisches Verfahren geprüft, da Spekulationen über mögliche Cyberangriffe geäußert wurden, wenngleich führende Politiker dies bisher zurückweisen. Die Wiederherstellung der Stromversorgung zeigt beispielhaft den Einsatz moderner Technologie und menschlichen Fachwissens in Kombination. Die Experten mussten Sicherheitsaudits durchführen, um Leitungen, Transformatoren und Schaltkreise auf Schäden zu überprüfen, die möglicherweise einen weiteren Ausfall auslösen könnten. Ebenso gewann die Kommunikation zwischen den Netzbetreibern, Dienstleistern und der Öffentlichkeit an Bedeutung, um Vertrauen und Ruhe zu bewahren. Dieser Vorfall offenbart auch den Einfluss der veränderten Verbrauchsmuster.