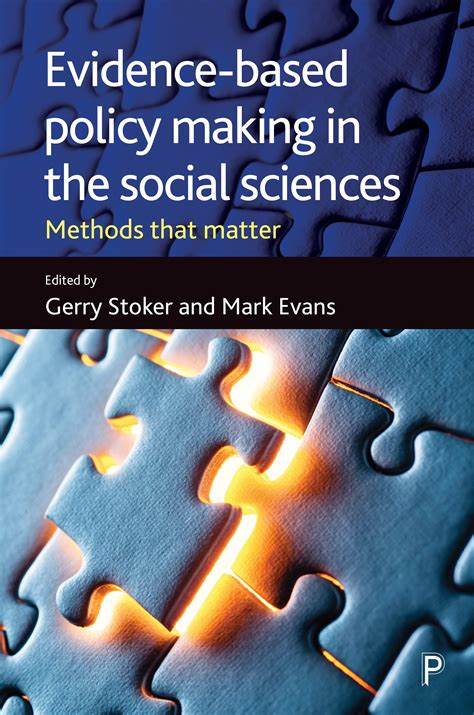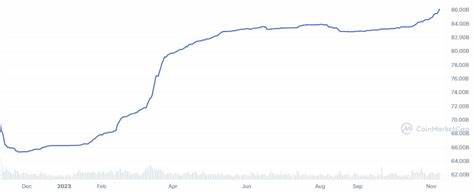Evidenzbasierte Politik gilt als Ideal moderner Regierungsführung. Die Vorstellung, politische Entscheidungen auf fundierten, wissenschaftlich geprüften Erkenntnissen zu stützen, verspricht mehr Effizienz und Gerechtigkeit. Doch die Realität sieht oft anders aus: Zwar wächst die Fülle an wissenschaftlicher Literatur stetig, doch die Qualität vieler Veröffentlichungen in den Sozialwissenschaften lässt zu wünschen übrig. Für politische Entscheidungsträger ist es deshalb keineswegs einfach, verlässliche Forschungsergebnisse zu identifizieren und anzuwenden. Dies setzt die Effektivität und Glaubwürdigkeit evidenzbasierter Politik von Anfang an erheblich unter Druck.
Ein zentrales Problem beginnt bereits bei der Reproduzierbarkeit der Studien. Wissenschaftliche Forschung sollte in der Lage sein, Ergebnisse durch wiederholte Analysen nachvollziehbar zu machen. In der sozialwissenschaftlichen Forschung ist dies jedoch vielfach nicht gegeben. Untersuchungen zeigen, dass nur ein Bruchteil der veröffentlichten Studien überhaupt mit dem bereitgestellten Code und Daten repliziert werden kann. Selbst in führenden Fachzeitschriften laufen von vielen Studien die Analysesoftware oder die bereitgestellten Datensätze nicht ohne Fehler, was Zweifel an der Validität der Ergebnisse nährt.
Diese mangelnde Reproduzierbarkeit ist mehr als ein technisches Detail. Sie verweist darauf, dass schon die Grundlage der Forschungsergebnisse unsicher ist. Wenn politische Programme oder Gesetze auf solchen Studien fußen, könnte ihre Wirkungserwartung auf sandigem Grund stehen. Ein weiteres Problem besteht darin, dass selbst korrekt ausführbare Analysen mit Fehlern im Code belastet sein können, die zu verzerrten Ergebnissen führen. Beispielsweise kann eine fehlerhafte Datenmanipulation oder eine falsche Variablenkodierung zwar die Analysen nicht zum Absturz bringen, aber trotzdem die Ergebnisse erheblich verfälschen.
Doch nicht nur technische Fehler bringen die Wissenschaft ins Wanken. Die Flexibilität in der Datenanalyse macht soziale Forschung besonders anfällig für sogenannte „forsche Pfade“ – Entscheidungsprozesse, bei denen Forscher ihre methodischen Ansätze und Datenbearbeitungen mehrfach anpassen, bis die Ergebnisse überzeugend erscheinen. Meist geschieht dies unbewusst, aber die Folge ist, dass die Ergebnisse fragil sind und von kleinsten methodischen Änderungen stark abweichen können. Dies erschwert eine verlässliche Interpretation der Forschung und schwächt die Grundlage für fundierte politische Entscheidungen. Ein weiterer kaum zu unterschätzender Faktor ist die geringe statistische Aussagekraft vieler Studien.
Viele wissenschaftliche Arbeiten sind unter „niedriger Stichprobengröße“ und damit schwacher statistischer Power leidend. Folglich treten effiziente Effekte oftmals gar nicht zutage oder werden durch zufällige Schwankungen über- oder unterschätzt. Für politische Entscheider bedeutet dies, dass selbst jene Forschungsergebnisse, die publikationsfähig sind und eine statistische Signifikanz aufweisen, den wahren Effekt der untersuchten Intervention häufig verzerrt darstellen. Eine Überbewertung der Wirksamkeit von Programmen kann dadurch zum teuren Risiko werden. Die Suche nach signifikanter Wirkung führt zudem zu einer systematischen Verzerrung im Publikationsprozess.
Journale bevorzugen Studien, welche einen statistisch signifikanten Effekt zeigen, während Null- oder negative Resultate oft gar nicht veröffentlicht werden. Dieses Phänomen, bekannt als Publikationsbias, führt zu einer verzerrten Literatur, die den Anschein erweckt, als seien Interventionen wirkungsvoller oder häufiger erfolgreich, als dies tatsächlich der Fall ist. Für politische Akteure verliert die Evidenz damit ihre Aussagekraft als objektive Grundlage einer Entscheidung. Trotz dieser Probleme ist ein vollständiger Verzicht auf sozialwissenschaftliche Forschung für die Politik keine Option. Es gibt Glanzlichter: Einige Forschungsfelder und Studien zeichnen sich durch hohe Reproduzierbarkeit, große Stichproben und robuste Effekte aus.
Programme wie das Graduation-Programm, das mit finanzielle Unterstützung, Schulung und Betreuung Armut bekämpft, wurden mehrfach repliziert und zeigen konsistente Erfolge. Erfolgreiche Metaanalysen und rigorose Langzeitstudien schaffen wertvolle Erkenntnisse, auf die Politik bauen kann. Dennoch bleibt die Herausforderung bestehen, wie man aus der Masse der Studien verlässlich brauchbare Erkenntnisse extrahiert. Aktuell sind der Aufwand für eine gründliche Bewertung der Forschungshintergründe und -qualität für politisch Handelnde oft zu hoch. Wissenschaftskommunikation, die sich dieser Problematik annimmt, muss Standards setzen, Kriterien zur Bewertung der Qualität transparent machen und Hilfestellungen bieten, um glaubwürdige Studien schnell von fragwürdigen zu unterscheiden.
Verschiedene Reformansätze haben sich in den letzten Jahren abzeichnet. So fordern Expertinnen und Experten mehr Transparenz durch verpflichtende Veröffentlichung von Daten und Analysesoftware. Einige führende Fachzeitschriften prüfen inzwischen vor der Veröffentlichung, ob Analyseschritte vollständig nachvollziehbar sind. Im Bereich der Peer-Review-Prozesse werden sogenannte „Registered Reports“ diskutiert, bei denen Studienvorschläge schon vor der Datenerhebung bewertet werden, um Publikationsbias entgegenzuwirken. Technologische Innovationen, darunter der Einsatz von Künstlicher Intelligenz, könnten zukünftig beim automatisierten Prüfen von Daten und Code helfen.
Plattformen für offene Evaluationen sollen eine kontinuierliche Bewertung von Forschung durch Fachkollegen ermöglichen, die ihre Einschätzungen öffentlich teilen. Dies kann nachhaltige Transparenz und Vertrauen schaffen, das Politikern die Auswahl verlässlicher Studien erleichtert. Trotz aller technischer und methodischer Fortschritte liegt die größte Herausforderung in der Veränderung der wissenschaftlichen Kultur selbst. Der akademische Anreizmechanismus belohnt zu oft Neuheit und spektakuläre Ergebnisse, statt Stein auf Stein langfristig reproduzierbare Evidenz zu schaffen. Solange Transparenz, Replikationsbemühungen und methodische Stringenz nicht stärker honoriert werden, wird der Druck auf Forscher bleiben, „positive“ Ergebnisse zu erzeugen und sich an fragwürdigen Praktiken zu orientieren.
Evidenzbasierte Politik braucht also neben besseren Verfahren auch koordinierte Anstrengungen von Fachverlagen, Förderinstitutionen und Universitäten. Nur wenn die Belohnungsstrukturen in der Wissenschaft so angepasst werden, dass Verlässlichkeit und offene Wissenschaft kernige Werte sind, kann sich die Qualität der sozialwissenschaftlichen Forschung auf ein Niveau heben, das politische Entscheidungen tatsächlich fundiert unterstützt. Für die politische Praxis bedeutet dies eine zweigleisige Herangehensweise: Einerseits müssen Entscheidungsträger mit wissenschaftlicher Methodik vertraut und kritisch bleiben, Forschungsergebnisse stets hinterfragen und mehrere Evidenzquellen vergleichen. Andererseits ist es zentral, die systemischen Defizite in der wissenschaftlichen Produktion anzuerkennen und politische Rahmenbedingungen zu fördern, die eine qualitativ bessere Forschung ermöglichen. Schlussendlich steht und fällt die Vision evidenzbasierter Politik mit der Fähigkeit der Sozialwissenschaften, belastbare und transparente Forschung zu produzieren.
Nur so lassen sich ressourcenverschwendende Irrwege vermeiden und tatsächlich positive gesellschaftliche Veränderungen gestalten. Die Reform der Forschungslandschaft hin zu einer Kultur der Offenheit, Reproduzierbarkeit und methodischen Solidität ist daher kein Luxus, sondern eine dringende Notwendigkeit für eine verantwortungsvolle und zukunftsfähige Politikgestaltung.