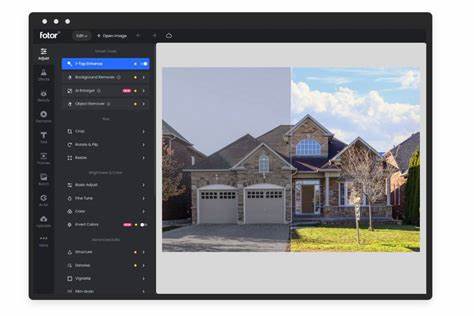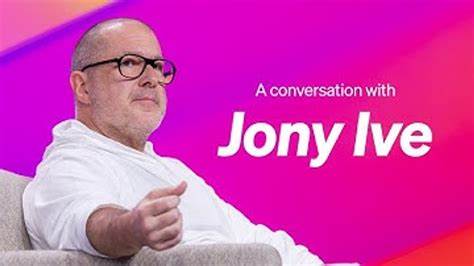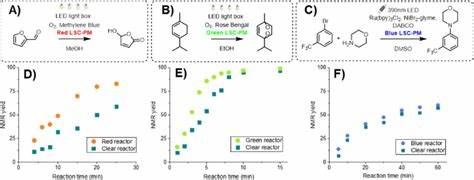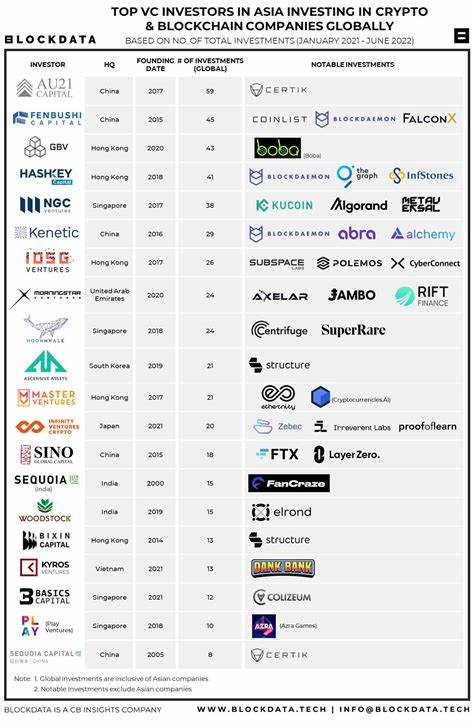Im August 2018 veröffentlichte National Geographic eine eindrucksvolle Reportage über einen stark ausgemergelten Eisbären, der auf der Insel Somerset im kanadischen Arktisgebiet aufgenommen wurde. Das Bild und das begleitende Video gingen viral und erreichten weltweit Milliarden von Menschen. Der Fotograf Paul Nicklen und die Meeresbiologin sowie Fotografin Cristina Mittermeier berichteten von einer Begegnung, die sie zutiefst bewegte und die zugleich eine komplexe Debatte über Medien, Wissen und das Thema Klimawandel in der Öffentlichkeit auslöste. Die Geschichte begann mit der zufälligen Entdeckung eines geschwächten Eisbären auf einer kleinen Reisegruppe durch die arktische Wildnis. Dieser Bär schien seinem nahen Ende entgegenzusehen – sichtbar abgemagert, seine Fellfarbe kaum noch erkennbar, jeder Schritt schien ihm Schmerzen zu bereiten.
Paul Nicklen alarmierte sofort das SeaLegacy-Team, eine von Mittermeier mitbegründete Organisation, die sich mit Fotografie für den Schutz der Meere einsetzt. Ziel war es, mit authentischem Storytelling die Menschen für die brennenden Probleme des Klimawandels zu sensibilisieren. Bei der Ankunft an der Bucht herrschte eine trostlose Stille. Ein verlassenes Fischcamp, verrottete Gebäude, alte Ölfässer – und irgendwo lag dieser fast leblos erscheinende Eisbär. Die Besucher beobachteten mit gemischten Gefühlen, wie der Bär kaum Kräfte hatte, sich zu bewegen, und verzweifelt nach Nahrung suchte.
Trotz des Offensichtlichen war niemand sicher, warum dieser einzelne Bär in einem derartigen Zustand war. War es Hunger? War er verletzt? Oder war es das Ergebnis veränderter Umweltbedingungen? Die Wissenschaft kann in einem einzelnen Fall oftmals keine eindeutige Ursache für das Leiden eines einzelnen Tieres benennen. Der veröffentlichte Clip enthielt die Botschaft „Das ist, wie Hunger aussieht“. Daraus entstand eine breite Diskussion: Einerseits löste die Darstellung Empathie und Handlungsbereitschaft bei vielen Menschen aus, andererseits führte sie zu heftigen Kontroversen und Missverständnissen. National Geographic verzichtete nicht darauf, den Klimawandel als Hintergrundkontext in der Einleitung zu benennen, was wiederum bei einigen Zuschauern den Eindruck erweckte, das Schicksal dieses einzelnen Bären sei definitiv eine direkte Folge des Klimawandels.
Doch Wissenschaftler und auch die Fotografen selbst betonen, dass ein einzelner Einzelfall selten eindeutige Verbindungen herstellt. Zwar gilt als gesichert, dass die schmelzenden Meereisflächen durch die Erderwärmung die Lebensgrundlage der Eisbären massiv bedrohen, doch die genauen Umstände des Hungerns dieses speziellen Tieres bleiben unklar. Die rasche Ausbreitung des Videos und dessen Übersetzung in viele Sprachen trug jedoch maßgeblich dazu bei, ein globales Bewusstsein für die Auswirkungen des Klimawandels zu schaffen. Es wurde schnell zum meist angesehenen Video auf der National Geographic Website und erreichte Medien und Nutzer rund um den Globus. Die Reaktionen der Öffentlichkeit ließen nicht lange auf sich warten.
Manche Zuschauer stellten die unmögliche Frage, warum das Team dem Bären nicht geholfen habe, etwa indem man ihn mit Nahrung oder medizinischer Versorgung versorgte. Doch solche Eingriffe sind nicht nur unmöglich in der Wildnis, sondern auch oft sinnlos oder gar schädlich, da wilde Tiere auf ihre natürliche Umgebung angewiesen sind und Eingriffe das ökologische Gleichgewicht gefährden würden. Zudem wäre eine Traumatisierung oder gar der Tod wahrscheinlich gewesen, wenn Menschen versucht hätten, den Bären zu retten – was die Situation weiter verschärft hätte. Andere Kommentare zeigten eine traurige Distanz zum Tierreich und zur ökologischen Realität. Das Bild offenbarte, wie viele Menschen heute wenig Verständnis für Wildtiere, deren Lebensraum und die komplexen ökologischen Zusammenhänge besitzen.
Dazu kommt eine wachsende Fraktion von sogenannten Klimawandelleugnern, die solche Fälle als Übertreibung darstellen und die Wissenschaft in Zweifel ziehen. Für Cristina Mittermeier wurde das Ereignis zu einem Lehrstück darüber, wie wichtig es ist, Bilder und Geschichten verantwortungsvoll zu erzählen. Sie gab im Nachhinein zu, dass das Team vielleicht zu sehr in der Hoffnung lebte, mit einem einzigen starken Bild die Zukunft vorwegzunehmen. Dabei hätte man vielleicht besser offen kommunizieren sollen, dass die Aufnahme einen Moment in einem größeren Prozess repräsentiert, aber nicht zwangsweise die gesamte Wahrheit eines individuellen Falles vermittelt. Die realen Bedingungen im sich rapide erwärmenden Arktisraum sind unbestreitbar dramatisch.
Eisbären sind auf Meereis als Jagdplattform angewiesen, um Robben und andere Meeressäuger zu erbeuten. Je länger das Eis in jedem Jahr schmilzt, desto weniger Möglichkeiten für diese Tiere zum Jagen bleiben. Das führt zu längeren Hungerperioden an Land und einem höheren Risiko für Unterernährung und Tod. Die Situation vieler Eisbären spiegelt deshalb eine langfristige Bedrohung wider, deren spürbare Auswirkungen wir zunehmend beobachten können, auch wenn wir den genauen Tod jedes einzelnen Tieres nicht kausal zurückverfolgen können. Der Fotograf Paul Nicklen, der den Eisbären filmte, äußerte seine Sorge, dass der Bär durch das Schwimmen ins offene Wasser seine wenigen Kräfte verschwenden könnte.
Doch das Tier zeigte überraschenderweise eine erstaunliche Beweglichkeit im Wasser und verschwand schließlich um die nächste Biegung der Küste. Niemand weiß, wie es ihm danach erging. Seither betonen die Organisatoren der Expedition, wie wichtig es ist, weiterhin den Dialog über den Klimawandel offen und ehrlich zu führen – ohne Übertreibungen, aber mit emotionaler Kraft. Bilder wie die des verhungernden Eisbären können wachrütteln und zum Handeln motivieren, bergen aber auch die Gefahr, dass wichtige Nuancen verloren gehen. Die Geschichte dieses einen Bären symbolisiert den Kampf um den Fortbestand einer gesamten Spezies in einer sich verändernden Welt.
Sie verdeutlicht die Notwendigkeit, den Klimawandel und seine Konsequenzen auf einer breiten gesellschaftlichen Ebene zu verstehen, zu akzeptieren und wirkungsvoll zu bekämpfen. Gleichzeitig fordert sie dazu auf, Respekt gegenüber den komplexen Zusammenhängen der Natur zu entwickeln und nie die menschliche Verantwortung aus den Augen zu verlieren. Ein Jahr nach dem viral gehenden Video erklärt Cristina Mittermeier, dass es trotz aller Kritik unbezahlbar ist, solche Momente zu dokumentieren und der Welt zugänglich zu machen. Ihre Fotos und Videos leisten einen Beitrag dazu, die Schönheit und zugleich die Zerbrechlichkeit der arktischen Ökosysteme sichtbar zu machen. Nur so können globale Entscheidungen beeinflusst und das Bewusstsein dafür geschärft werden, dass jeder Einzelne eine Rolle beim Erhalt unseres Planeten spielt.



![US Army Secretary requires right to repair for ALL contracts [video]](/images/A7852232-D880-4EC4-813B-6CE345293E51)