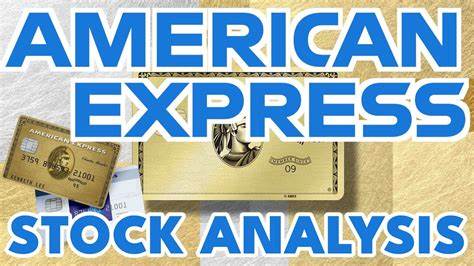Seit mehreren Jahren sorgt ein medizinisches Rätsel in der kanadischen Provinz New Brunswick für große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, bei Fachleuten und vor allem bei betroffenen Familien. Verdachtsfälle von scheinbar unerklärlichen neurologischen Symptomen hatten Spekulationen über eine neue, bisher unbekannte Gehirnerkrankung entfacht – ein Szenario, das bei Patienten, Angehörigen und Behörden gleichermaßen Besorgnis auslöste. Nun aber bringt eine aktuelle, peer-reviewed Studie, veröffentlicht im angesehenen Journal of the American Medical Association, eine entscheidende Wendung: Es gibt keine Belege für eine neue neurologische Krankheit. Stattdessen beruhen die Symptome auf bereits bekannten Erkrankungen und einer Reihe von Fehldiagnosen, ergänzt durch Missverständnisse und mangelnde Information. Diese Erkenntnisse geben nicht nur Aufschluss über die medizinische Faktenlage, sondern werfen auch wichtige Fragen zum Umgang mit solchen epidemiologischen Fällen auf.
Die Untersuchung entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität Toronto, dem Horizon Gesundheitsnetzwerk New Brunswick und weiteren kanadischen Institutionen. Im Fokus stand eine detaillierte Neubewertung von 25 einzelnen Fällen aus einer ursprünglich größeren Gruppe von 222 Verdachtsfällen, die der Moncton-basierte Neurologe Alier Marrero zuvor betreut hatte. Dabei zeigten sich erhebliche Diskrepanzen zwischen den vorliegenden Diagnosen und den Ergebnissen der unabhängigen Forschung. Die Mehrheit der untersuchten Patientinnen und Patienten litt demnach an bekannten neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson, funktionellen neurologischen Störungen, Folgen von Schädelhirntraumen oder sogar metastasiertem Krebs. Die Analyse von 11 Autopsiefällen unterstützte die Schlussfolgerung, dass die Wahrscheinlichkeit einer neuartigen Krankheit extrem gering ist – weniger als 0,1 Prozent.
Die Ärztinnen und Ärzte stellten fest, dass „Fehldiagnosen und Fehlinformationen“ im Zusammenspiel einen gravierenden Schaden anrichten können. Gerade im Ausmaß und in der Unsicherheit solcher komplexer Krankheitsbilder erlangt die Qualität medizinischer Diagnostik besondere Bedeutung. Dabei sollen klare, evidenzbasierte Untersuchungen und Interpretation vor Vermutungen oder ungeprüften Hypothesen stehen. Tatsächlich lehnten über die Hälfte der zur Studie eingeladenen Patientinnen und Patienten eine Teilnahme ab, was das Bild vermutlich zusätzlich komplizierte. Die Provinz New Brunswick war im Jahr 2021 erstmals mit der Warnung konfrontiert, dass etwa 40 Bewohner an einer unbekannten neurologischen Erkrankung litten, deren Symptome an das seltene degenerative Gehirnsyndrom Creutzfeldt-Jakob erinnerten.
Die betroffenen Personen waren zum Teil über Monate von ihrem Hausarzt oder anderen Ärztinnen und Ärzten zu Dr. Marrero überwiesen worden, nachdem diese mit der Diagnose überfordert waren. Doch schon im Folgejahr kam ein von der Provinz eingesetztes unabhängiges Gremium zu dem Ergebnis, dass es sich bei fast allen Fällen um bekannte Krankheiten handle und kein „Cluster“ eines neuen neurologischen Syndroms vorliege. Diese Schlussfolgerung führte zur Einstellung der offiziellen Untersuchungen durch die Provinzbehörden und ließ die mediale Diskussion vorerst abebben. Parallel zur Studie gab es jedoch innerhalb der medizinischen Community und einiger Behörden noch andere Stimmen.
Ein prominenter Bundeswissenschaftler äußerte Bedenken, dass möglicherweise doch ein reales Problem existiere, das bislang nicht ausreichend erforscht oder anerkannt werde. Zudem gab es Berichte, wonach die Fallzahlen deutlich höher seien als öffentlich gemacht, sowie Hinweise, dass die Untersuchungen zu früh abgebrochen wurden. Offenbar hätten notwendige finanzielle und personelle Ressourcen für eine umfassendere Erforschung nicht bereitgestellt oder genutzt werden können. Auch Dr. Marrero selbst meldete sich in einer Stellungnahme zu Wort, zeigte sich aber tief enttäuscht über die neue Studie und deren Methoden, die ohne sein Wissen und Einverständnis durchgeführt worden seien.
Nach eigenen Angaben hat er inzwischen weitere Fälle dokumentiert, die sich nicht nur auf New Brunswick begrenzen, sondern auch andere kanadische Provinzen wie Nova Scotia, Prince Edward Island, Neufundland, Ontario, Quebec und Alberta betreffen. Besonders besorgniserregend erscheint ihm, dass auch jüngere Menschen unter 45 Jahren Symptome zeigen. Für viele Patientengruppen und Angehörige ist das Thema weit mehr als eine medizinisch-statistische Angelegenheit. Sie vermuten Umweltfaktoren als Ursache – zum Beispiel Schadstoffe wie Pestizide oder Schwermetalle – und kritisieren die offizielle Linie, die solche Szenarien nicht ausreichend berücksichtige. Für sie ist die Erklärung, dass es sich um Fehldiagnosen handelt, unbefriedigend und unter Umständen gar beschämend.
Gleichzeitig zeigen die Forscher, dass die Überbewertung von ergänzenden Diagnosetests und unzureichende systematische Erhebungen die Verwirrung verstärkt und die Verbreitung von Fehlinformationen begünstigt haben. Dies habe den psychosozialen Schaden für Patientinnen und Patienten unnötig vergrößert. Die politische Führung New Brunswicks hat sich unterdessen zum Ziel gesetzt, die Angelegenheit weiterhin ernst zu nehmen und eine gründliche und transparente Untersuchung zu gewährleisten. Die neue Premierministerin Susan Holt betonte, dass alles unternommen werden müsse, um „Licht in die Angelegenheit zu bringen“ und für die betroffene Bevölkerung eine Lösung zu finden. Auch Chief Medical Officer Dr.
Yves Léger zeigte sich überzeugt davon, dass die laufende Provinzuntersuchung basierend auf allen verfügbaren Fallzahlen fortgeführt werde. Ein Update mit Empfehlungen soll in den kommenden Monaten veröffentlicht werden, und die Behörden haben eine öffentliche Webseite zum Informationsaustausch eingerichtet. Der Fall aus New Brunswick ist exemplarisch für die Herausforderungen, die beim Umgang mit vermeintlichen „neuen“ Krankheitsbildern entstehen können. Einerseits zeigt er, wie wichtig fundierte wissenschaftliche Analyse und unabhängige Überprüfung sind, um Spekulationen und Panik vorzubeugen. Andererseits werden auch systemische Schwächen und Kommunikationsdefizite deutlich, die sowohl auf der Seite der Medizin als auch bei Behörden und Patienten auftreten können.
Dies birgt die Gefahr, dass Misstrauen entsteht und Betroffene sich nicht ausreichend unterstützt fühlen. Die Balance zwischen gründlicher Diagnostik und dem notwendigen Fingerspitzengefühl im Umgang mit belastenden Krankheitsverläufen wird dabei somit zu einer zentralen Herausforderung für moderne Gesundheitssysteme. In Hinblick auf zukünftige vergleichbare Situationen ist erkennbar, dass institutsübergreifende Kooperation, offene Kommunikationsstrategien und die Einbeziehung von Patientengruppen entscheidend sein können, wenn es darum geht, medizinische Unsicherheiten und gesellschaftliche Ängste zu bewältigen. Die Erfahrung aus New Brunswick könnte den Weg weisen, wie komplexe medizinische Phänomene in einer regional begrenzten Bevölkerung besser untersucht und gesellschaftlich eingeordnet werden können – zum Wohl der Betroffenen und der Allgemeinheit. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in New Brunswick ein medizinisches Rätsel gelöst wurde, das über Jahre Ängste geschürt hatte.
Die aktuelle wissenschaftliche Evidenz entkräftet den Verdacht auf eine bisher unbekannte Gehirnerkrankung und weist darauf hin, dass beobachtete Symptome auf bekannte neurologische Krankheiten und nicht auf eine neue Pathologie zurückzuführen sind. Trotz dieser Klarstellung bleibt die Aufgabe, das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen, offene Fragen zu adressieren und bestmögliche Versorgung sicherzustellen. Die Diskussion um Umweltfaktoren und individuelle Krankheitsverläufe wird weiterhin präsent bleiben und fordert nachhaltige Aufmerksamkeit von Medizin, Politik und Gesellschaft gleichermaßen.