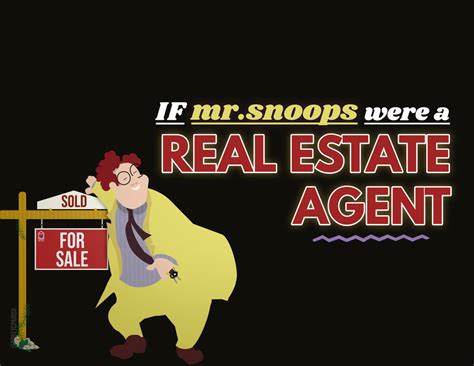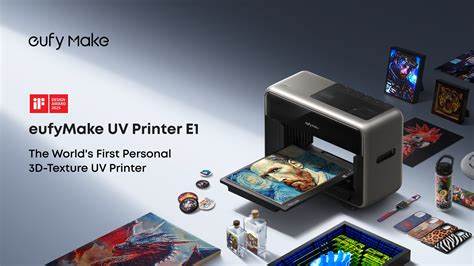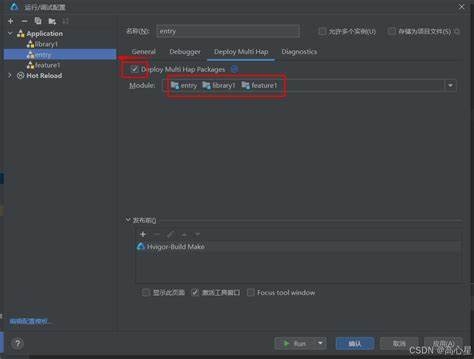Die Vorstellung, Alexander der Große würde statt nach Osten in das Perserreich nach Westen ziehen, ist eine faszinierende historische Spekulation, die Archäologen, Historiker und Militärstrategen schon lange beschäftigt. Was wäre, wenn der makedonische König seine gewaltige Armee in Richtung Italien und die westlichen Mittelmeerländer geschickt hätte, anstatt durch Klein- und Zentralasien zu marschieren? Zwar war schon zu Lebzeiten Alexanders der Plan für den Angriff gegen das Perserreich festgesetzt, doch erlaubt das Gedankenexperiment tiefere Einblicke in die militärischen, politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des antiken Italiens und einen Vergleich mit Alexanders realen Feldzügen im Orient. Es entlarvt zudem die Grenzen selbst der brillantesten militärischen Führer angesichts komplexer geopolitischer Realitäten. Die Ausgangssituation im Italien des 4. Jahrhunderts vor Christus war fundamental anders als jene im Perserreich.
Italien war ein Flickenteppich von Volksgruppen, Stadtstaaten und Stämmen, die meist autonom agierten und sich teils bekämpften. Dieses Mosaik bestand aus Römern, Samniten, Etruskern, keltischen Völkern wie den Senonen, griechischen Kolonien in Süditalien und den rivalisierenden Stadtstaaten im sizilianischen Raum wie Syrakus und der Macht Carthagos. Anders als in Asien gab es keinen einzigen, dominanten Imperator oder Herrscher, der ein Großreich zusammenhielt – die politische Landschaft war zersplittert, mit einer Vielzahl gleichwertiger Akteure, die allesamt über ausreichende militärische Mittel verfügten, um eine einzelne Fremdarmee herauszufordern. Aus militärischer Sicht kommt erschwerend hinzu, dass das italische Kriegswesen sich von Alexanders makedonischen Streitkräften erheblich unterschied. Die 40.
000 Mann starke Armee Alexanders war eine fein ausbalancierte, schlagkräftige Kombination aus schwerer Infanterie, Kavallerie und spezialisierter Unterstützung, entwickelt für schnelle, entschiedene Schlachten auf offenen Feldern. Dagegen setzte sich das italo-gallische Heer oft aus unruhigen und schweren Infanteristen, versierten leichten Truppen sowie einer größeren Zahl unabhängiger Verbände zusammen. Die Stringenz und Disziplin des makedonischen Phalanx schien kaum in Einklang zu bringen mit der fragmentierten Kriegsführung der diversen italischen Gemeinschaften. Dennoch hatten letztere durch langandauernde Konflikte Erfahrung gesammelt, die Gegner nicht unterschätzen durften. Ein weiteres Problem, mit dem Alexander konfrontiert gewesen wäre, ist die Logistik in Italien.
Anders als Persien mit großen, zentralisierten Versorgungswegen verfügte Italien über ein Terrain mit zerklüfteten Hügeln, Mittelgebirgen und zahlreichen befestigten Städten, die selten kampflos aufgegeben wurden. Der Erfolg Alexanders im Osten basierte auch stark auf der Fähigkeit, eroberte Städte zur Unterwerfung und Versorgung seiner Truppe zu bewegen. Viele Städte gaben Alexander freiwillig Ressourcen und Militärvorräte, um plündernde Belagerungen zu vermeiden. In Italien hätten hartnäckige Stadtbewohner und Bergstämme eher Widerstand geleistet. Die Folge wären langwierige Belagerungen und ein zermürbendes „Whack-a-Mole“-Spiel gewesen, welches Alexanders schnelle offensive Kriegsführung stark beeinträchtigt hätte.
Die politische Fédération Italiens war im Umbruch. Während die römische Republik auf dem Vormarsch war und langsam begann, die umliegenden Gebiete zu dominieren, hatten die Samniten zwar schon erhebliche Verluste einstecken müssen, zeigten sich aber weiterhin als erhebliche Kraft. Pyrrhus von Epirus, ein makedonischer Stilist und militärischer Zeitgenosse, hatte in den Jahren 280–275 v. Chr. den Römern mit seiner relativ kleinen, aber hochmobiliären Armee ernsthaft zugesetzt.
Diese Erfahrung dient als wichtiges Referenzbeispiel, um einzuschätzen, wie Alexander, mit einer ähnlichen Heeresstruktur, auch Schwierigkeiten gehabt hätte. Pyrrhus konnte zwar einige Schlachten gewinnen, aber letztlich nicht das gesamte Italien erobern, was die Widerstandsfähigkeit der Römer und ihrer Verbündeten gegen einen hochklassigen Feldherrn unterstreicht. Interessant ist auch die finanzielle Seite der Unternehmung. Alexanders eigentliche Feldzüge wurden nämlich durch den durchschlagenden Erfolg gegen das Perserreich finanziert, allein der Raub des persischen Schatzhauses von Persepolis versorgte seine Truppen mit den nötigen Silbermitteln für Lohn und Nachschub. In Italien hingegen hätte Alexander auf diese Ressourcen verzichten müssen.
Die italienische Halbinsel verfügte nur über wenig ausgeprägte Silber- und Goldvorkommen. Die römische Wirtschaft stützte sich größtenteils auf Bronzemünzen und ein formales Geldsystem, das sich erst später voll entfalten sollte. Die Finanzierung einer langwierigen Kampagne gegen mehrere gleichwertige Mächte in Italien hätte deshalb erheblich schwierigere Bedingungen mit sich gebracht und sein Heer womöglich schnell in Auflösung getrieben. Neben den materiellen Problemen hätte Alexander vermutlich auch mit strategischen Jugendsünden zu kämpfen gehabt. Seine Armee war nicht darauf ausgelegt, über Jahre hinweg sich in einem dauerhaften Stellungskrieg mit zahlreichen Aufständen und Querelen aufzureiben.
Das historische Beispiel zeigt, dass die Römer – wie auch später die Hellenistischen Königreiche – durch ihre Fähigkeit, quasi endlos neue Truppen aufzustellen, die von Loyalität und Staatsideologie durchdrungen waren, in der Lage waren, Rückschläge zu verkraften und fortzusetzen. Alexander hingegen hatte eine begrenzte regionale Basis, seine Truppen waren größtenteils ethnisch gebunden und zeigten irgendwann sehr wohl Ermüdungserscheinungen und Demoralisierung, was sich bei der tatsächlichen Indienkampagne zeigte. Was würde passieren, wenn Alexander den Feldzug nicht im Alter von 26 startete, sondern nach seiner historischen Rückkehr etwa um 323 v. Chr., wo er bereits eine immense territoriale Machtbasis und Ressourcen zur Verfügung hatte? Die Fragen sind komplex: Einerseits hätte er durch seine Machtfülle eine robuste Flotte aufbauen können, die Kontrolle über das Mittelmeer hätte sichern können und somit logistische Hindernisse überwinden können.
Andererseits hätte er mit erheblichen Unruhen in seinen neuen östlichen Provinzen kämpfen müssen, die ihn langfristig an die Heimat banden. Die Legitimität Macedoniens in Griechenland wäre erneuert von Aufständen gepeinigt gewesen; aber eine ganz andere Herausforderung wäre nun die schiere Größe des untergeordneten Territoriums, dessen dauerhafte Verwaltung die konventionellen Hellenistischen Nachfolger bereits überforderte. In jedem Fall wäre Alexanders Italienfeldzug eine gewaltige strategische Herausforderung gewesen, die seine gewohnten Blitzkriegstaktiken durch einen zermürbenden Guerillakrieg, Städtebelagerungen, politische Ränkespiele und wirtschaftliche Schwierigkeiten ersetzt hätte. Die Zeit der schnellen, entscheidenden Schlachten gegen ein zerfallendes Großreich wäre vorbei gewesen. Stattdessen hätte sich eine lukrative politische Meisterleistung vor ihm ausgebreitet, die Fähigkeit zur Diplomatie, zur Integration von lokalen Eliten und zur virtuellen Verwaltung zahlloser kleiner Herrschaften vorausgesetzt hätte.
Die historischen Parallelen zu Pyrrhus von Epirus, der es auch nur zu einer begrenzten Hegemonie bringen konnte, oder zu Hannibal, der trotz spektakulärer Siege es ebenso nie schaffte, Rom zu brechen, sind unverkennbar. Die mittelitalienischen und toskanischen Völker waren keine leicht zu erobernden Schulknaben, sondern gelenkte, seit Jahrhunderten geübte Krieger und Politiker, die sich gegen bereits ferne Mächte wehrten. Auch sie könnten gezwungen haben, neue Bündnisse zu schmieden, wenn Alexander als Feldherr auftauchte. Letztlich zeigt die historische Untersuchung, dass vielleicht gerade die Zerklüftung und das Fehlen eines einzigen großen, strukturierten Imperiums der Grund war, warum Alexander sich gen Osten wandte. Die Reichtümer des Perserreichs, die klaren Befehlshierarchien, die logistischen Vorteile und sein persönlicher Plan waren auf den Orient ausgerichtet.
Italien wäre ein hausgemachter Albtraum für eine Armee gewesen, die schnelle Siege gewohnt war. Ein abschließender Gedanke: Alexander hätte zwar Italien erobern können, doch die dauerhafte politische Konsolidierung wäre vielleicht nie zustande gekommen. Seine Nachfolger hätten in einem bruchstückhaften Machtgefüge mit unzähligen Gegnern rivalisieren müssen, ähnlich wie es auch bei den Diadochenkriegen nach seinem Tod im Osten allerdings weitaus mehr territoriales Kapital zur Verfügung stand. Vielleicht hätte Alexander selbst, nach langem Entschluss, die halbe Zeit seines Lebens gebraucht, um Italien zu beherrschen – und das nur bis zu einem friedlichen Bruch seines Reiches oder gar einem Rückzug. Die Legende eines Alexander, der den Westen erobert, bleibt ein spannendes Gedankenspiel, das aber zeigt, dass Tod und Politik oft größere Faktoren sind als die Genialität des Feldherrn.
Es ist eine Erinnerung daran, dass selbst die größten Eroberer der Geschichte ihren Platz, ihre Grenzen und den Kontext brauchten, um wirklich erfolgreich zu sein – und dass die Geschichte vielleicht gerade deshalb so faszinierend bleibt, weil das Unmögliche oft am dünnen Firnis des tatsächlich Möglichen kratzt.