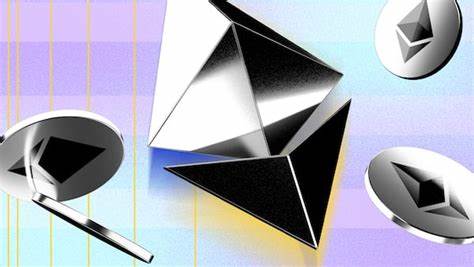Die USA waren jahrzehntelang einer der wichtigsten Standorte für wissenschaftliche Konferenzen weltweit. Ihre Universitäten und Forschungseinrichtungen zogen Forscherinnen und Forscher aus aller Welt an, die sich hier vernetzten, Erkenntnisse austauschten und Kooperationen schmiedeten. Doch in den letzten Jahren hat sich das Bild deutlich gewandelt. Anlass gibt vor allem die zunehmend restriktive US-Einwanderungs- und Grenzpolitik, die bei vielen internationalen Forschern für erhebliche Unsicherheiten und Ängste sorgt. Als Folge ziehen Veranstalter akademischer Konferenzen Konsequenzen: Sie verlegen Treffen ins Ausland, verschieben Termine oder sagen Veranstaltungen komplett ab.
Die Folge ist eine spürbare Schwächung des wissenschaftlichen Austauschs und ein potenzieller Verlust an Forschungsqualität und Innovationskraft. Die Angst vieler Forschender, bei der Einreise in die USA Schwierigkeiten zu bekommen, ist nicht unbegründet. Es berichten zahlreiche akademische Fachkräfte über lange und komplizierte Visa-Prozesse, wiederholte Ablehnungen, oder sogar über unangenehme Befragungen und Festhaltungen an Grenzkontrollen. Besonders betroffen sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Ländern, die von verschärften Einreisebestimmungen besonders stark belastet werden. Diese Unsicherheiten wirken sich unmittelbar auf die Planungen und Entscheidungen von Konferenzveranstaltern aus, die zunehmend Kooperationen mit US-Standorten überdenken.
Darüber hinaus ist die logistische Herausforderung für Konferenzbesucher enorm gestiegen. Während die Organisation eines internationalen Treffens ohnehin mit komplexen Anforderungen verbunden ist, sorgt der zusätzliche Faktor der Einreisehürden für Planungsunsicherheiten. Teilnehmer möchten nicht riskieren, wegen Visa-Problemen nicht rechtzeitig anreisen zu können oder gar von der Einreise ausgeschlossen zu werden. Viele Entscheidungsträger in akademischen Einrichtungen und Fachgesellschaften ziehen daher in Erwägung, Konferenzen künftig an andere, besser zugängliche Orte zu verlegen. Europa, Asien und Kanada werden als Alternativen immer beliebter.
Die Umsiedlung von Konferenzen wirkt sich auf vielfältige Weise auf die Wissenschaft aus. Zum einen wird die internationale Vernetzung erschwert. Persönliche Begegnungen sind für den wissenschaftlichen Fortschritt essenziell, um Vertrauen aufzubauen, Ideen spontan auszutauschen und neue Kooperationen zu initiieren. Digitale Alternativen können physische Treffen nur bedingt ersetzen. Zum anderen kann der Wegfall von renommierten US-Tagungen den wissenschaftlichen Nachwuchs treffen, der dort wichtige Chancen zur Präsentation seiner Forschung und zum Netzwerken erhält.
Doch nicht nur Forscherinnen und Forscher sowie Veranstalter stehen vor Herausforderungen. Auch die US-Wissenschaftsinstitutionen selbst spüren die Auswirkungen der veränderten Lage. Die USA könnten langfristig an Attraktivität als Forschungsstandort verlieren. Die Abwanderung von Konferenzen bedeutet nicht nur einen Imageverlust, sondern auch entgeht der amerikanischen Wissenschaft und Wirtschaft die Möglichkeit, internationale Expertise vor Ort zu bündeln. Kooperationen und Technologietransfer könnten rückläufig sein, was Wachstum und Innovationsdynamik beeinträchtigen kann.
Die politische Dimension darf ebenfalls nicht unterschätzt werden. Angesichts der Wettbewerbsfähigkeit internationaler Forschung stehen die USA im globalen Rennen um Spitzenwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler unter Druck. Länder wie Deutschland, die Niederlande, Kanada oder Japan profitieren potenziell von der Verlagerung wissenschaftlicher Veranstaltungen und könnten ihre Rolle als internationale Wissenschaftsdrehkreuze ausbauen. Das amerikanische Beispiel zeigt, wie eng Politik und Forschung miteinander verknüpft sind und wie politische Entscheidungen unmittelbaren Einfluss auf den Wissenschaftsstandort haben. Einige Initiativen versuchen, die negativen Effekte abzumildern.
So werden hybride Tagungen, die einen Teil der Teilnahme digital ermöglichen, zunehmend angeboten, um zumindest virtuelle Teilnahmen zu erleichtern. Auch bemühen sich Fachgesellschaften verstärkt, Visa-Probleme frühzeitig zu adressieren und ihre Mitglieder aktiv über die komplexen Anforderungen zu informieren. Dennoch ersetzt dies nicht die Vorteile persönlicher Begegnungen. Insgesamt zeichnet sich ein Wandel im globalen wissenschaftlichen Ökosystem ab. Nationalstaatliche Grenzkontrollen und restriktive Einreisepolitiken können das internationale Miteinander und den freien Wissensaustausch erheblich beeinträchtigen.
Gerade in einer Zeit, in der globale Herausforderungen wie Klimawandel, Pandemien oder technologische Umbrüche gemeinsames internationales Handeln erfordern, wirkt sich die Einschränkung grenzüberschreitender Mobilität kontraproduktiv aus. Die USA stehen daher vor der schwierigen Aufgabe, ihre Einwanderungspraxis und Grenzpolitik wissenschaftsfreundlicher zu gestalten, um nicht den Anschluss zu verlieren. Für Forschende und Veranstalter gilt es, flexibel auf die neue Realität zu reagieren, um den wissenschaftlichen Dialog am Leben zu halten, sei es im Ausland, digital oder in hybriden Formaten. Die Zukunft wissenschaftlicher Konferenzen hängt damit maßgeblich von der Balance zwischen Sicherheitserfordernissen und Offenheit für internationale Zusammenarbeit ab. Die Entscheidung vieler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Konferenzen außerhalb der USA vorzuziehen, ist ein deutliches Signal an politische und akademische Entscheidungsträger.
ForscherInnen weltweit brauchen einen freien und verlässlichen Zugang zu internationalen Begegnungen, um Innovation und Fortschritt voranzutreiben. Die wissenschaftliche Gemeinschaft ist zunehmend vernetzt und global ausgerichtet – Grenzen dürfen nicht zur Barriere für den Wissensaustausch werden. Die Herausforderung besteht darin, eine Atmosphäre zu schaffen, die nicht nur den Schutz von Staaten gewährleistet, sondern auch die wissenschaftliche Exzellenz fördert und internationale Forschung ermöglicht. Langfristig könnte dieser Trend zu einem Umdenken führen, das den Standort USA vor neue Herausforderungen stellt, aber zugleich auch Chancen für andere Wissenschaftsstandorte eröffnet. Internationale Spitzenforscherinnen und -forscher werden ihre Konferenzteilnahmen und Forschungspartnerschaften immer stärker anhand von Zugänglichkeit und Offenheit der Gastländer wählen.
Für den Wissenschaftsstandort USA gilt es deshalb, Wege zu finden, diese Bedenken abzubauen und Vertrauen wiederherzustellen. Erst dann kann die Rückkehr zu einer offenen und inklusiven Forschungslandschaft gelingen, von der alle profitieren.