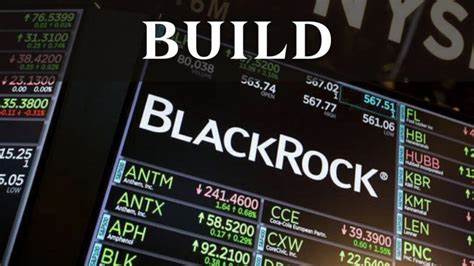Der US-Senat hat am 17. Juni 2025 das GENIUS-Gesetz zur Regulierung von Stablecoins verabschiedet. Das Ergebnis der Abstimmung fiel mit 68 zu 30 Stimmen relativ deutlich aus und zeigt eine unerwartete parteiübergreifende Einigkeit im Umgang mit der boomenden Kryptowährungswelt. Das Gesetz zielt darauf ab, klare Rahmenbedingungen für Herausgeber von Stablecoins zu schaffen, um so den Verbraucherschutz zu erhöhen, Geldwäsche vorzubeugen und für ein stabiles Umfeld im wachsenden Digitalwährungsmarkt zu sorgen. Die Verabschiedung des Gesetzes wird von der Kryptoindustrie vielfach begrüßt.
Dennoch gibt es gewichtige Stimmen, die vor einem möglichen systemischen Risiko warnen, das sich durch die engen Verflechtungen zwischen Stablecoins und dem US-Staatsanleihemarkt ergeben könnte. Das GENIUS-Gesetz schreibt unter anderem eine 1-zu-1 Unterlegung der Stablecoins mit liquiden Reserven vor, die vorzugsweise in US-Dollar oder kurzfristigen US-Staatsanleihen gehalten werden müssen. Laut Senator Bill Hagerty aus Tennessee, der das Gesetz initiiert hat, soll so die Nachfrage nach US-Staatsanleihen gestärkt, der US-Dollar als Leitwährung zementiert und der Verbraucherschutz verbessert werden. Dieses Ziel stößt jedoch nicht bei allen Experten auf Zustimmung. Prof.
Yesha Yadav von der Vanderbilt University und Brendan Malone, ehemaliger Mitarbeiter im Bereich Zahlungsverkehr und Clearing bei der Federal Reserve, warnen eindringlich vor den möglichen Risiken, die aus der starken Kopplung von Stablecoins an den US-Treasury-Markt entstehen können. Insbesondere sehen sie das Problem, dass Stablecoin-Herausgeber durch die vorgeschriebene 1-zu-1 Deckung de facto zu Großabnehmern von US-Staatsanleihen gemacht werden. Das kann zu erheblichen Marktverwerfungen führen, wenn der Stablecoin-Markt weiter wächst, so Yadav und Malone in einer Analyse vom Juni 2025. Die Zahlen sprechen für sich: Die ausstehenden Stablecoin-Ansprüche wuchsen in den vergangenen fünf Jahren von wenigen Milliarden Dollar auf über 230 Milliarden Dollar Anfang 2025. Im Vergleich zum Volumen des sekundären Treasury-Marktes, das sich auf circa 900 Milliarden Dollar beläuft, ist das eine sehr beachtliche Größenordnung.
Bei einer Krise eines großen Stablecoin-Anbieters könnte die Notwendigkeit, massive Mengen an Staatsanleihen zu verkaufen, auf einen Markt treffen, der in den letzten Jahren zunehmend mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen hat. Diese Probleme sind verursacht durch mehrere Faktoren. Zum einen haben sich Marktteilnehmer verändert: Automatisierte, hochfrequente Händler und neue wettbewerbsintensive Akteure dominieren heute Märkte, wodurch traditionelle Banken und Broker weniger direkt in sekundäre Treasury-Geschäfte eingebunden sind. Zum anderen erfordern verschärfte Regulierungen, die nach der Finanzkrise 2008 eingeführt wurden, dass Banken wesentlich größere Kapitalpuffer vorhalten. Diese Entwicklung führt dazu, dass Banken Anreize haben, sich aus vielen Bereichen des Treasury-Handels zurückzuziehen.
Diese Kombination aus reduzierter Teilnehmeranzahl und gestiegenem Kapitalbedarf erhöht die Illiquidität im Markt und erschwert größere, plötzliche Positionstransaktionen wie sie etwa bei einem Stablecoin-Rückruf nötig wären. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Anforderung des GENIUS-Gesetzes, dass Stablecoins bevorzugt mit kurzfristigen Staatsanleihen unterlegt werden. Der US-Treasury-Markt setzt sich normalerweise aus einer Mischung von kurz-, mittel- und langfristigen Anleihen zusammen. Die stärkere Fokussierung auf kurzfristige Instrumente könnte die Finanzierungsstruktur der US-Regierung beeinflussen und zu höheren Kosten oder strategisch weniger günstigen Finanzierungsentscheidungen führen. Kurzfristige Anleihen haben zwar eine höhere Flexibilität, können aber auch anfälliger für Zinsschwankungen sein.
Dies bringt Unsicherheiten für Haushaltsplanungen in Washington mit sich, da langfristige Vorhaben oft auf stabile und kalkulierbare Refinanzierungen angewiesen sind. Die Autoren der kritischen Studie weisen ferner darauf hin, dass kurzfristige Liquiditätsengpässe im Treasury-Markt keineswegs theoretisch sind. So kam es beispielsweise während der COVID-19-Pandemie im März 2020 zu einer ausgeprägten Liquiditätskrise, bei der Investoren Schwierigkeiten hatten, Staatsanleihen zu handeln, was zu heftigen Preisverzerrungen führte. Ähnliche Ereignisse wurden auch im April 2025 beobachtet, als unerwartete politische Entscheidungen im Bereich Handelspolitik die Märkte verunsicherten und die Liquidität in US-Treasuries vorübergehend stark beeinträchtigten. Die potenziellen Konsequenzen eines ausgedehnten Stablecoin-Marktes, der stark mit dem Treasury-Markt verflochten ist, sind also vielseitig.
Im ungünstigen Fall könnte eine plötzliche Krise oder ein Vertrauensverlust in etablierte Stablecoin-Anbieter zu einem sogenannten „Run“ auf die Einlösungen führen. Aufgrund der mangelnden Liquidität im Treasury-Markt könnten diese Anbieter Schwierigkeiten haben, ihre Staatsanleihenbestände zu realisieren. Ein Scheitern oder eine Insolvenz eines großen Stablecoin-Anbieters hätte dann vermutlich nicht nur negative Auswirkungen auf die Kryptoindustrie, sondern könnte auch das Vertrauen in die amerikanischen Staatsanleihemärkte erschüttern und dadurch breitere Finanzmärkte destabilisieren. Um solchen Szenarien vorzubeugen, plädieren Experten für eine engere Abstimmung zwischen Regulierungsbehörden, die für Stablecoins sowie für US-Treasuries zuständig sind. Bislang gibt es jedoch keine zentrale Instanz, die die Aufsicht koordinieren könnte.
Stattdessen sind fünf verschiedene Bundesbehörden involviert, keine davon mit klarer Führungsverantwortung. Zudem werden kleinere Stablecoins auf Staatsebene reguliert, während größere unter die Aufsicht von Bundesbehörden wie dem Office of the Comptroller of the Currency oder der Federal Reserve fallen. Diese komplexe, fragmentierte Aufsicht erschwert eine Kohärenz der Regulierung und kann potenziell neue Risiken erzeugen. Einige Stimmen schlagen vor, dass die Federal Reserve oder der Financial Stability Oversight Council eine stärkere koordinierende Rolle einnehmen sollten, doch auch dies ist rechtlich und institutionell nicht leicht umsetzbar. Abseits der regulatorischen Unsicherheiten gibt es auch politische Kritik.
Vor allem Demokraten wie Senatorin Elizabeth Warren oder Kongressabgeordnete Maxine Waters äußern sich skeptisch gegenüber dem Gesetz. Sie befürchten, dass das GENIUS-Gesetz zugunsten der Kryptoindustrie und großer Interessengruppen gestalten wurde und unzureichenden Verbraucherschutz biete. Zudem wird spekuliert, dass ehemalige Präsident Donald Trump und seine Verbindungen zum Kryptobereich durch die Gesetzgebung profitieren könnten, was in den politischen Debatten für erheblichen Widerstand sorgt. Auf dem Weg zum Gesetz müssen die Senatsbestimmungen nun mit dem STABLE Act, einem ähnlichen Gesetz aus dem Repräsentantenhaus, abgestimmt werden. Hier bestehen noch Differenzen beim Umfang der Regulierung, der Behandlung von algorithmischen Stablecoins und der Aufsicht zwischen Bundes- und Landesregulierern.
Die finale Gestaltung des Gesetzes könnte daher noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das GENIUS-Gesetz einen wichtigen Schritt zur Regulierung von Stablecoins in den USA markiert. Die Verabschiedung im Senat signalisiert eine neue Phase politischer Akzeptanz gegenüber digitalen Währungen. Dennoch sind die mit der engen Verbindung zwischen Stablecoins und US-Treasuries einhergehenden Risiken nicht zu unterschätzen. Insbesondere im Hinblick auf die Marktliquidität, die Funktionsweise der Staatsanleihemärkte und mögliche Auswirkungen auf die staatliche Finanzpolitik besteht großer Handlungsbedarf.
Die künftige Entwicklung wird entscheidend davon abhängen, inwieweit die beteiligten Regulierungsbehörden erfolgreich zusammenarbeiten können, um ein stabiles und sicheres Umfeld für Stablecoins zu schaffen, ohne die Solidität der US-Finanzmärkte zu gefährden. Die zunehmende Bedeutung von Stablecoins als Teil der US-Finanzinfrastruktur ist unbestritten, doch diese Integration muss sorgfältig gestaltet werden, um die Vorteile digitaler Währungen voll auszuschöpfen und gleichzeitig die Schwachstellen beider Systeme zu adressieren.