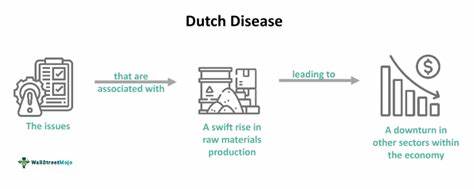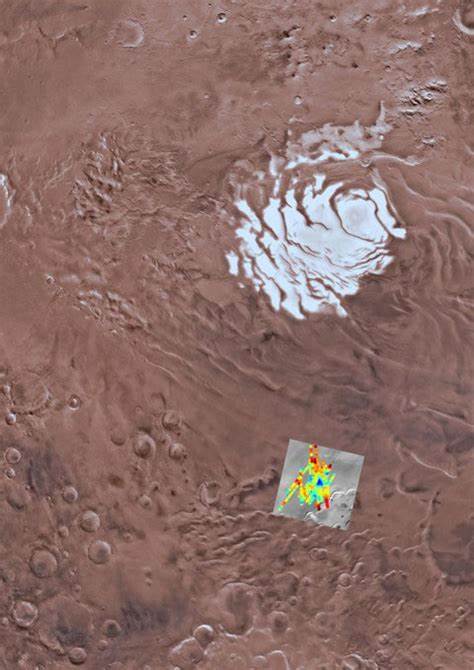Die sogenannte Niederländische Krankheit ist ein komplexes wirtschaftliches Phänomen, das häufig in Ländern mit reichhaltigen natürlichen Ressourcen auftritt. Dabei führt ein schneller Anstieg der Einnahmen aus einem bestimmten Wirtschaftssektor, meist dem Rohstoffsektor, zu einer negativen Entwicklung anderer Wirtschaftszweige wie der verarbeitenden Industrie oder der Landwirtschaft. Trotz der unverkennbaren Vorteile eines Ressourcenbooms können dadurch langfristig fundamentale wirtschaftliche Probleme entstehen, die das Wachstum und die Diversifikation einer Volkswirtschaft behindern. Der Begriff Niederländische Krankheit wurde erstmals im Jahr 1977 von der britischen Wirtschaftspublikation The Economist geprägt. Der Ursprung liegt in den wirtschaftlichen Entwicklungen der Niederlande nach der Entdeckung großer Erdgasvorkommen im Jahr 1959 im Groningen-Gasfeld.
Während die Einnahmen aus dem Erdgasexport stark zunahmen, kam es zu einem Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit anderer Sektoren, insbesondere der Industrie. Die Wechselkursaufwertung durch erhöhte Deviseneinnahmen machte Exportgüter aus anderen Branchen teurer und Importe vergleichsweise günstiger, was zum Rückgang der Industriekapazitäten führte. Das Grundprinzip hinter diesem Effekt ist der sogenannte Realaufwertung des Wechselkurses. Wenn ein Land aufgrund eines Rohstoffbooms oder großer Geldzuflüsse eine starke Nachfrage nach seiner Währung erfährt, steigt deren Wert gegenüber anderen Währungen. Dadurch verteuern sich exportorientierte Produkte außerhalb des boomenden Sektors für ausländische Käufer, während Importe günstiger werden.
Folglich wird der heimische Markt zunehmend abhängig von den importierten Waren und die eigene Industrie verliert an Bedeutung. Die wirtschaftlichen Modelle, die dieses Phänomen beschreiben, gehen häufig auf die Arbeiten von W. Max Corden und J. Peter Neary aus dem Jahr 1982 zurück. Sie unterteilen die Volkswirtschaft in zwei handelbare Sektoren – den boomenden Rohstoffsektor und den zurückbleibenden verarbeitenden Sektor – sowie in einen nicht handelbaren Dienstleistungssektor.
Ein Rohstoffboom führt sowohl zu einem sogenannten Ressourcenbewegungseffekt als auch zu einem Ausgabeneffekt. Der Ressourcenbewegungseffekt beschreibt, dass Arbeitskräfte aufgrund höherer Löhne und Nachfrage vom verarbeitenden Gewerbe in den Rohstoffsektor abwandern, was zu einer direkten Deindustrialisierung führt. Da der Rohstoffsektor jedoch häufig kapitalintensiv und arbeitsarm ist, fällt dieser Effekt in der Praxis oft weniger ins Gewicht. Spürbarer ist dagegen der Ausgabeneffekt, der durch den steigenden Staatseinnahmen und damit erhöhte Ausgaben in nicht handelbaren Sektoren wie Dienstleistungen ausgelöst wird. Hier verschieben sich Arbeitskräfte vom verarbeitenden Gewerbe in den Dienstleistungssektor, die Preise für nicht handelbare Güter steigen und der reale Wechselkurs wird weiter aufgewertet.
Diese indirekte Deindustrialisierung beeinflusst die Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Landes langfristig. Auf internationaler Ebene lässt sich die Niederländische Krankheit anhand von Handelsmodellen und Theoremen wie dem Heckscher-Ohlin-Modell oder dem Rybczynski-Theorem erklären. Länder tendieren dazu, sich auf Ressourcen zu spezialisieren, in denen sie einen komparativen Vorteil besitzen. Doch dieses Fachwissen bringt Risiken mit sich. Der starke Fokus auf den Rohstoffsektor bedeutet oft, dass technologische Innovationen und Produktivitätssteigerungen in anderen Sektoren auf der Strecke bleiben.
Dies erschwert eine spätere Wiederaufnahme der industriellen Entwicklung, insbesondere wenn die Ressourcen erschöpft sind oder die Rohstoffpreise sinken. Des Weiteren sind Rohstoffmärkte volatil, was zu unsicheren Zukunftsaussichten führt und private Investitionen hemmt. Erwartete Einnahmen aus Rohstoffexporten können stark schwanken, und eine übermäßige Abhängigkeit von diesen kann zu makroökonomischer Instabilität führen. Die hohe Kapitalintensität der Rohstoffbranche schafft zudem vergleichsweise wenige neue Arbeitsplätze, was soziale Probleme verschärfen kann. Vielfach findet sich die Niederländische Krankheit in verschiedenen Regionen der Welt wieder und dient als warnendes Beispiel für Volkswirtschaften, die von Ressourcenreichtum profitieren, diesen Vorteil jedoch nicht nachhaltig nutzen.
Historische Fälle wie der Goldimport in Spanien und Portugal im 16. Jahrhundert oder der australische Goldrausch im 19. Jahrhundert illustrieren, wie plötzlicher Reichtum negative Effekte auf andere Wirtschaftszweige haben kann. Im 20. Jahrhundert waren Länder wie Kuwait, Norwegen, das Vereinigte Königreich und sogar Kanada von den Auswirkungen betroffen, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß.
Regionale Effekte sind ebenfalls bemerkenswert. Beispielsweise hat das Wachstum des Finanzsektors in London seit den 1980er Jahren zu einem Ungleichgewicht geführt, das als Finanzfluch bezeichnet wird und die industrielle Basis vor Ort geschwächt hat. Ähnlich beeinflussen Rohstoffpreise in Ländern wie Nigeria und Venezuela das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht nachhaltig. Um den negativen Auswirkungen der Niederländischen Krankheit entgegenzuwirken, existieren verschiedene Strategien. Ein zentraler Ansatz ist die langsame und kontrollierte Nutzung der Rohstoffeinnahmen durch die Einrichtung von sogenannten Sovereign Wealth Funds.
Diese Staatsfonds speichern einen Teil der Einnahmen im Ausland, um übermäßige Inlandsnachfrage und Realaufwertung zu vermeiden und künftigen Generationen finanzielle Mittel zu sichern. Beispiele dafür sind der Norwegische Staatsfonds, der Future Fund Australiens oder der Ölfonds von Kuwait. Darüber hinaus können gesamtwirtschaftliche Maßnahmen wie budgetäre Überschüsse, die Förderung privater Ersparnisse durch Steuererleichterungen und Investitionen in Bildung sowie Infrastruktur die Wettbewerbsfähigkeit des verarbeitenden Gewerbes und der Landwirtschaft stärken. Manche Regierungen versuchen auch, durch Subventionen oder Zölle bestimmte Sektoren zu schützen, doch solche protektionistischen Maßnahmen laufen teilweise Gefahr, das Problem des realen Wechselkurswachstums noch zu verschärfen. Die Diagnostik der Niederländischen Krankheit gestaltet sich oft schwierig, da Wechselkursaufwertungen auch durch produktivitätsbedingte Effekte, externe Kapitalzuflüsse oder Veränderungen der Terms of Trade ausgelöst werden können.
Aktuelle Forschungsarbeiten betonen jedoch, dass insbesondere überraschende und große Ressourcenausschöpfungen oft zu den typischen Symptomen dieser Krankheit führen. Langfristig ist die Diversifikation der Volkswirtschaft eine der besten Möglichkeiten, um den Risiken einer einseitigen Rohstoffabhängigkeit zu begegnen. Länder, die attraktive Rahmenbedingungen für Innovationen und technologische Entwicklung schaffen, sind besser aufgestellt, um potenzielle Abschwünge im Rohstoffsektor auszugleichen. Insgesamt ist die Niederländische Krankheit ein Phänomen mit tiefgreifenden Auswirkungen auf die Ökonomie von rohstoffreichen Ländern. Sie verdeutlicht, dass plötzlicher Reichtum nicht automatisch zu wirtschaftlichem Wohlstand führt, sondern ohne kluge und vorausschauende Wirtschaftspolitik langfristig Wachstum und Stabilität bedroht.
Die Herausforderung liegt darin, den Rohstoffsektor als Hebel für nachhaltige Entwicklung zu nutzen, ohne andere wichtige Wirtschaftsbereiche zu vernachlässigen. Nur so können auch zukünftige Generationen von den natürlichen Ressourcen profitieren und die Volkswirtschaft breiter aufgestellt und widerstandsfähiger machen.