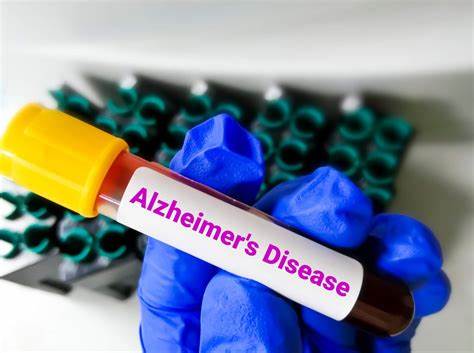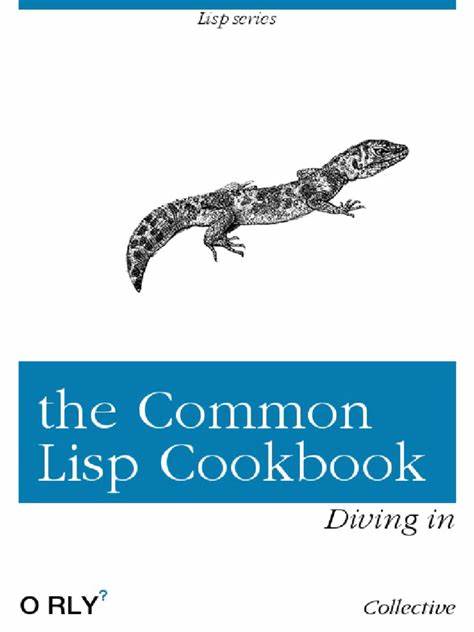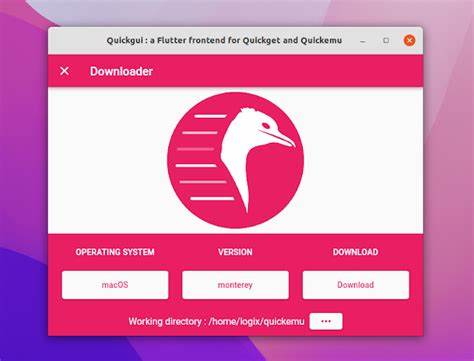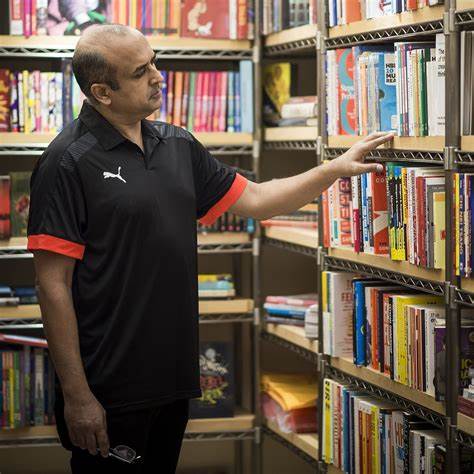Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, kurz SSRIs, zählen zu den am häufigsten verschriebenen Medikamenten gegen Depressionen und andere psychische Erkrankungen. Sie wirken, indem sie die Aufnahme von Serotonin in den präsynaptischen Nervenzellen hemmen und so den Serotoninspiegel im synaptischen Spalt erhöhen. SSRIs wie Fluoxetin, Paroxetin und Sertralin genießen wegen ihres relativ günstigen Sicherheitsprofils sowie ihrer Wirksamkeit große Beliebtheit. Dennoch mehren sich Hinweise darauf, dass diese Medikamente nicht risikofrei sind, insbesondere bezüglich ihrer möglichen Nebenwirkungen auf das Herz. Neueste Studien enthüllen ausgeprägte kardiotoxische Effekte, die durch Funktionsstörungen der Mitochondrien und der sarkomerischen Struktur der Herzmuskelzellen hervorgerufen werden können.
Mitochondrien als Kraftwerke der Zellen spielen eine zentrale Rolle in der Energieversorgung, indem sie ATP herstellen, das essentielle Energieträgermolekül. Im Herzmuskel sind sie besonders zahlreich und unverzichtbar für die Kontraktion und den Erhalt der Herzfunktion. Störungen in der mitochondrialen Funktion können daher die Herzleistung erheblich beeinträchtigen. Sarkomere stellen die kleinsten kontraktilen Einheiten in den Herzmuskelzellen dar und sind für die mechanische Pumpfunktion des Herzens zuständig. Die Integrität und Organisation der Sarkomere sind direkt mit einer gesunden Herzfunktion verknüpft.
Forschung mit humanen pluripotenten Stammzellen, die zu Herzmuskelzellen differenziert werden, liefert wertvolle Einblicke in die molekularen Auswirkungen von SSRIs auf das herzentwickelnde System. In zweidimensionalen Zellkulturen sowie dreidimensionalen Herzorganoid-Modellen zeigen SSRIs, selbst bei klinisch relevanten Konzentrationen, eine deutliche Beeinträchtigung der mitochondrialen Atmung und der ATP-Erzeugung. Diese Störungen manifestieren sich durch einen erhöhten oxidativen Stress, der durch eine übermäßige Bildung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) gekennzeichnet ist, sowie durch eine verminderte Energieproduktion, was die Zellgesundheit und -funktion nachhaltig beeinträchtigt.Darüber hinaus beobachten die Studien eine strukturelle Desorganisation der Sarkomere in den Herzmuskelzellen nach SSRIs-Exposition. Insbesondere der Ausdruck des Myosin-Schwerketten-Gens MYH7 ist signifikant reduziert, was auf eine gestörte Ausbildung und Funktion der kontraktilen Einheiten im Herzmuskel hindeutet.
Diese Veränderungen können funktionelle Defizite wie verminderte Kontraktilität und erhöhte Anfälligkeit für kardiale Erkrankungen zur Folge haben.Der Mechanismus hinter der mitochondrialen Dysfunktion beinhaltet auch eine veränderte Expression regulatorischer Gene wie PGAM5, das eine Rolle bei der mitochondrialen Spaltung und der zellulären Antwort auf mitochondriale Schäden spielt. Eine Überaktivierung dieses Signalsystems kann zu einer verstärkten Fragmentierung der Mitochondrien und zu einer Aktivierung programmierten Zelltods führen, insbesondere unter Bedingungen anhaltenden oxidativen Stresses.Im Kontext der Schwangerschaft ist der Einsatz von SSRIs besonders kritisch. Strukturelle Defekte des Herzens bei Neugeborenen und Anpassungssyndrome nach der Geburt werden mit expositiver Behandlung während der Schwangerschaft in Verbindung gebracht.
Das placentaübergreifende Passieren von SSRIs ermöglicht einen direkten Einfluss auf die fetale Herzentwicklung, was das Risiko von kardiovaskulären Fehlbildungen erhöht. Die Untersuchung der 3D-Herzorganoide hat zudem gezeigt, dass SSRIs nicht nur die Muskelfunktion beeinträchtigen, sondern auch Prozesse wie die Angiogenese und die Entwicklung des kardiovaskulären Systems stören können.Die kardiotoxischen Effekte von SSRIs sind nicht auf die Entwicklung beschränkt, sondern könnten auch bei Erwachsenen zu Herzrhythmusstörungen, Veränderungen der Herzhypertrophie und weiteren kardiovaskulären Problemen führen. Klinische Berichte dokumentieren unerwünschte Wirkungen wie Bradykardie, Vorhofflimmern und erhöhte right-ventrikuläre Raumvolumen, die durch beeinträchtigte Herzmuskelzellfunktion erklärt werden können.Wichtig ist zu betonen, dass die in vitro untersuchten Konzentrationen der SSRIs sorgfältig an die klinisch beobachteten Blutspiegel angepasst sind, um realistische Rückschlüsse auf die pharmakologische Relevanz zu ermöglichen.
Die Verwendung humaner Stammzellenmodelle stellt hierbei einen bedeutenden Fortschritt dar, da sie die Speziesunterschiede, die bei Tiermodellen auftreten können, umgehen und spezifische menschliche Auswirkungen besser abbilden.Die Erhöhung der endogenen ROS durch SSRIs ist ein zentrales Thema, da oxidative Stressmechanismen die mitochondriale Dysfunktion verstärken und somit eine Abwärtsspirale aus Energiemangel und Zellschädigung in Gang setzen. Hierbei spielen antioxidative Abwehrmechanismen eine wichtige Rolle, die jedoch durch SSRIs offenbar hinreichend überfordert werden können. Die chronische Belastung der Zellen durch oxidativen Stress führt zudem zu gestörter mitochondrialer Biogenese und unzureichender Qualitätssicherung der Mitochondrien.Neben der direkten Effizienzminderung der Energieproduktion wird auch die morphologische Mitochondrienstruktur nach SSRIs-Exposition beeinträchtigt.
Die Mitochondrien weisen kürzere Verzweigungen und eine geringere Netzwerkkonnektivität auf, was für eine Raufragilität des mitochondrialen Netzwerks spricht. Dieses Phänomen geht mit einer verminderten Adaptivität der Zellen und einem erhöhten Risiko für den Zelluntergang einher.Die Störung der Sarkomerorganisation zeigt sich nicht nur in der reduzierten Genexpression, sondern lässt sich auch auf Ebene der Proteinstruktur nachweisen. Immunfluoreszenzfärbungen belegen eine verringerte Sarcomerlänge und eine schwächere Ordnung innerhalb der Herzmuskelzellen. Funktionell bedeutet dies eine verminderte Kraftentwicklung und Herzmuskelperformance.
Ein weiterer bemerkenswerter Befund betrifft die Veränderung in der Regulation von Angiogenese. Die erhöhte Expression von CD31, einem Markermolekül für Endothelzellen, weist auf eine SSRI-induzierte Stimulation der Neubildung von Blutgefäßen hin. Während Angiogenese grundsätzlich vorteilhaft sein kann, ist eine dysregulierte Neubildung in der Embryonalentwicklung mit Fehlbildungen und funktionellen Defiziten assoziiert.Parallel dazu wurde eine Abnahme des Expressionsniveaus von WT1 beobachtet, einem wichtigen Transkriptionsfaktor, der in der Herzentwicklung eine zentrale Rolle spielt. Dies deutet auf Beeinträchtigungen bei der morphogenetischen Organisation und Gewebeausbildung im sich entwickelnden Herz hin.
Die kardiovaskuläre Toxizität der SSRIs umfasst auch potenzielle Auswirkungen auf die Hämostase. Die erhöhte Expression von Genen, die in den Prozess der Blutgerinnung involviert sind, korreliert mit den klinisch dokumentierten Risiken von Blutungsneigungen unter SSRIs, was deren Einfluss auf die Plateletfunktion verdeutlicht.Nachhaltige kardiologische Gesundheit erfordert ein komplexes Gleichgewicht zwischen mitochondrialer Energieproduktion, struktureller Integrität der Muskelfasern und einer regulierten Angiogenese. SSRIs stören dieses Gleichgewicht durch mehrere parallele Mechanismen, die sich vor allem in der Entwicklung und beim Erwachsenen manifestieren können. Dies macht die kritische Neubewertung der Verordnungspraktiken, insbesondere bei Schwangeren, dringend notwendig.
Die Forschung rückt die Notwendigkeit in den Fokus, die Nebenwirkungen dieser oft als sicher erachteten Medikamente kritisch zu hinterfragen. Ein genaueres Verständnis der molekularen Pfade, die durch SSRIs beeinflusst werden, eröffnet Chancen für die Entwicklung sichererer Antidepressiva, welche die psychische Gesundheit effektiv unterstützen, ohne die Herzgesundheit zu kompromittieren.Zusammenfassend verdeutlichen die Studienergebnisse eindrücklich, dass die Selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer potenziell kardiotoxisch wirken können. Diese toxische Wirkung beruht wesentlich auf der Schädigung der mitochondriellen Funktion, einer erhöhten oxidativen Belastung und der Disorganisation der Sarkomere. Die daraus resultierende Beeinträchtigung der Herzmuskelzellfunktion kann schwerwiegende Folgen für das Herz und die gesamte kardiovaskuläre Gesundheit haben, insbesondere bei Langzeitanwendung und während der kritischen Phasen der Herzentwicklung im Embryo.
Die Integration fortgeschrittener Modelle wie humaner pluripotenter Stammzellen und Herzorganoide bietet künftig verbesserte Möglichkeiten, Risiken zu identifizieren und Therapieoptionen zu optimieren.