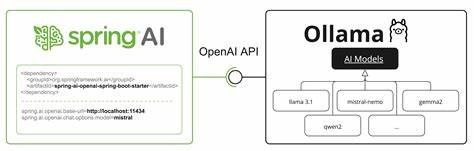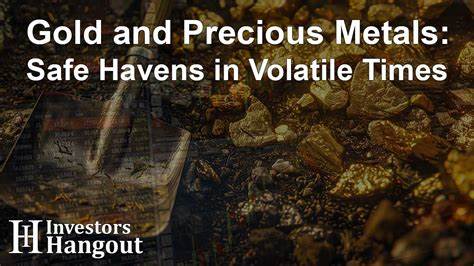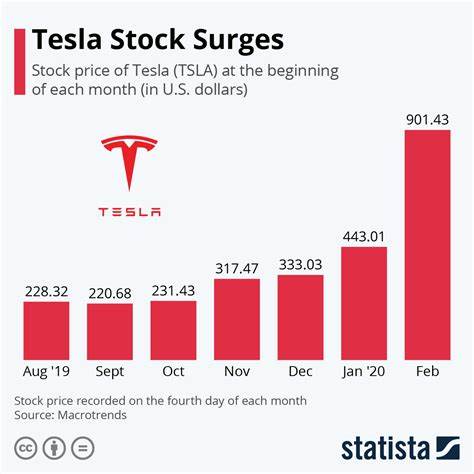Die Mobilitätswende hin zu Elektroautos und Hybridfahrzeugen gewinnt weltweit zunehmend an Bedeutung. Effizienz, Umweltfreundlichkeit und ein geringeres Geräuschniveau zeichnen diese Fahrzeuge aus. Gleichzeitig entstehen jedoch neue Herausforderungen im Straßenverkehr, vor allem im Hinblick auf die akustische Wahrnehmung dieser Fahrzeuge durch andere Verkehrsteilnehmer. Die besonders bei niedrigen Geschwindigkeiten eingesetzten Warnsignale, auch bekannt als AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), sollen Fußgänger, Radfahrer und andere vulnerable Nutzer vor herannahenden Fahrzeugen warnen. Doch aktuelle Forschungen zeigen, dass diese Warnsignale oft schwer zu lokalisieren sind und somit die Verkehrssicherheit beeinträchtigen können.
Die Universität Chalmers in Göteborg, Schweden, veröffentlichte eine wegweisende Studie, die sich intensiv mit der Wahrnehmung diverser akustischer Warnsignale von Elektro- und Hybridfahrzeugen auseinandersetzt. Im Fokus standen verschiedene Signaltypen, die im internationalen Vergleich weit verbreitet sind. Das Forschungsziel war es, herauszufinden, wie präzise Menschen die Richtung und Anzahl solcher Warnsignale bei langsamer Fahrzeugbewegung erkennen können. Die Ergebnisse offenbarten erhebliche Schwierigkeiten bei der Lokalisierung dieser Signale, insbesondere wenn mehrere Fahrzeuge gleichzeitig ähnliche Töne abgeben. Im Gegensatz zu den bekannten Motorengeräuschen von Verbrennungsmotoren, die als pulsierende und breitbandige Klänge wahrgenommen werden, bestehen die AVAS-Signale aus eher monotonen Tönen oder Rauschbildern.
Ein besonders herausfordernder Signaltyp besteht aus zwei Tonfrequenzen. Versuchspersonen in den akustisch optimierten Räumen der Chalmers Universität konnten bei gleichzeitiger Abspielung dieses Signals von bis zu drei Fahrzeugen in einem Radius von sieben bis acht Metern häufig weder die Richtung noch die Anzahl der Quellen zuverlässig bestimmen. Dieses Defizit ist besonders in belebten Umgebungen wie Parkplätzen oder verkehrsreichen Straßen kritisch, wo schnelle und präzise Orientierung Leben retten kann. Die internationale Regulierung von Warnsignalen für elektrisch angetriebene Fahrzeuge sieht vor, dass bei Geschwindigkeiten unter 20 km/h in Europa, China und Japan, sowie unter 30 km/h in den USA entsprechende akustische Signale verpflichtend ausgestoßen werden. Diese Signale dienen dazu, die ansonsten sehr leisen Fahrzeuge für schwächere Verkehrsteilnehmer hörbar zu machen.
Allerdings enthalten die geltenden Vorschriften keine konkreten Anforderungen an die Lokalisierbarkeit der Signale oder an die Unterscheidbarkeit bei mehreren gleichzeitig fahrende Fahrzeuge. Dies öffnet den Herstellern einerseits Gestaltungsspielraum, führt aber andererseits zu unterschiedlichen Klangsignaturen und in der Praxis zu Herausforderungen bei der Orientierung der Umwelt. Die Studie verdeutlicht, dass die derzeit eingesetzten AVAS-Signale trotz Erfüllung der Mindestanforderungen in der Praxis nicht immer optimal sind. Dies ist besonders problematisch, da für Fußgänger, mobilitätseingeschränkte Personen, Kinder und Radfahrer die Fähigkeit, die Richtung einer herannahenden Gefahr zu erkennen, von essenzieller Bedeutung für die Unfallvermeidung ist. Die vertrauten Motorengeräusche von Verbrennungsmotoren erleichtern aufgrund ihrer komplexen Frequenzmuster und Pulsationen die Richtungswahrnehmung.
Elektrofahrzeuge mit ihren meist konstanten, hochfrequenten Warnsignalen sind dagegen im akustischen Feld oft weniger eindeutig. Die visuelle Orientierung wird in urbanen Räumen durch Hindernisse eingeschränkt, und nicht selten sind auch die Sichtverhältnisse bei schlechter Beleuchtung oder dichtem Verkehr ungünstig. Daher nimmt der auditive Sinn eine entscheidende Rolle ein. Umso wichtiger ist es, dass die akustischen Warnsignale der elektrischen Fahrzeuge besser an die Wahrnehmungskapazitäten der Menschen angepasst werden. Zudem stellt der Hintergrundlärm, beispielsweise in einem ruhigen Stadtparkplatz mit gelegentlichen Verkehrsteilnehmern, eine weitere Hürde dar.
In den Laborversuchen der Chalmers-Forscher wurden reale Hintergrundgeräusche simuliert, um realistische Bedingungen zu schaffen. Die Kombination aus mehreren identischen Signalen und Hintergrundlärm führte zu einer deutlichen Abnahme der Lokalisierbarkeit und Unterscheidbarkeit der einzelnen Fahrzeuge. Die Forschungsteams betonen die Notwendigkeit, alternative akustische Signale zu entwickeln, die sowohl gut hörbar sind als auch die Richtung leichter erkennbar machen. Eine mögliche Lösung könnte in der Integration von komplexeren Klangstrukturen liegen, die Pulsationen und variierende Frequenzen enthalten, ähnlich den charakteristischen Geräuschen von Verbrennungsmotoren. Diese müssen so gestaltet werden, dass sie nicht als störender Verkehrslärm empfunden werden und die Umweltqualität nicht beeinträchtigen.
Neben der Entwicklung effektiverer Warnsignale steht auch die kontinuierliche Forschung über die menschliche Wahrnehmung im Fokus. Ein besseres Verständnis darüber, wie Menschen verschiedene Klänge im urbanen Umfeld wahrnehmen, könnte dazu beitragen, sicherere akustische Kommunikationssysteme für Fahrzeuge zu gestalten. Neben technischen Lösungsansätzen sehen Experten auch die gesetzgebenden Institutionen in der Pflicht, die aktuellen Vorschriften anzupassen, um sowohl die Detektierbarkeit als auch die Lokalisierbarkeit von AVAS-Warnsignalen zu regulieren. Die derzeitige Betonung auf das reine „Hörbarsein“ genügt offenbar nicht, um lebenswichtige auditive Orientierung sicherzustellen. Aus sozialer Perspektive ist es ebenso wichtig, die Akzeptanz der akustischen Warnsignale durch die Bevölkerung zu fördern.
Zu laute oder unangenehme Signale könnten zu Konflikten im öffentlichen Raum führen oder dazu, dass Menschen Schutzmechanismen wie das Abschalten von Geräten nutzen, was den Sicherheitseffekt verringert. Die Gestaltung der Signaltöne muss daher auch psychologische Faktoren berücksichtigen. Die Forschung an der Chalmers Universität setzt neue Maßstäbe, indem sie reale Verkehrssituationen, mehrfache Quellen und Umgebungsgeräusche in experimentelle Studien integriert. Solche praxisnahen Untersuchungen sind unerlässlich, um die Herausforderungen des modernen Fahrzeugverkehrs mit elektrischen Antrieben besser zu verstehen und praktikable Lösungen zu finden. In Zukunft könnten Fahrzeuge mit adaptiven AVAS-Systemen ausgestattet werden, die ihre akustischen Warnsignale je nach Umgebung variieren und auf intelligente Weise an die jeweilige Verkehrssituation anpassen.
Solche Technologien würden sowohl die Sicherheit erhöhen als auch den Geräuschpegel in Städten optimieren. Die Integration weiterer Sinnesmodalitäten, wie optische Warnsignale oder Vibrationen für mobilitätseingeschränkte Menschen, könnte ebenfalls die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen. Die Kombination verschiedener Warnsysteme bietet Chancen, unterschiedliche Bedürfnisse von Verkehrsteilnehmern besser zu erfüllen. Die stille Revolution der Elektromobilität verändert nicht nur die Art der Fortbewegung, sondern auch die Art und Weise, wie Menschen miteinander und mit ihrer Umwelt kommunizieren. Akustische Warnsignale sind ein essenzieller Bestandteil dieser Kommunikation, der noch weitreichend optimiert werden muss, um zu einer sicheren und inklusiven Mobilität der Zukunft beizutragen.
Abschließend lässt sich sagen, dass die Forschung an verbesserten Elektrofahrzeug-Warnsignalen ein wichtiger Baustein in der Entwicklung nachhaltiger und sicherer Verkehrssysteme ist. Die Balance zwischen Schallschutz und Sicherheit erfordert innovative Ansätze, die technische, menschliche und regulatorische Aspekte miteinander verbinden. Nur so kann die Vision einer emissionsfreien und gleichzeitig sicheren Mobilität Wirklichkeit werden.