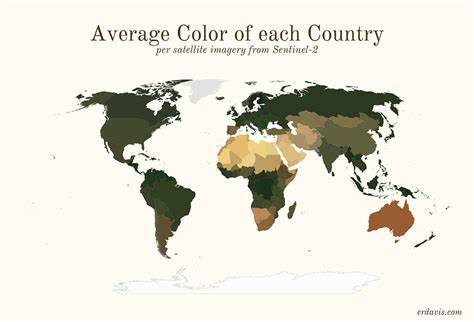Längst ist bekannt, dass Männer und Frauen unterschiedliche gesundheitliche Herausforderungen und Krankheitsverläufe aufweisen. Doch die genauen Ursachen für diese Unterschiede waren bislang nur zum Teil verstanden. Eine neue groß angelegte Studie unter der Leitung der Queen Mary University of London in Zusammenarbeit mit renommierten Wissenschaftsinstituten aus Berlin und Cambridge bringt nun wichtige Klarheit in die komplexe Beziehung zwischen Geschlecht, Genetik und Gesundheit. Die Ergebnisse, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Nature Communications, eröffnen neue Perspektiven für die präzise medizinische Behandlung und unterstreichen die Notwendigkeit, über rein genetische Erklärungen hinauszublicken.Die Studie analysierte genetische Daten von insgesamt 56.
000 Frauen und Männern aus der UK Biobank sowie der Fenland-Studie. Dabei wurden circa 6.000 unterschiedliche Proteine und deren Zusammenhang mit hunderten Erkrankungen untersucht. Überraschenderweise ergab sich, dass bei etwa zwei Dritteln der untersuchten Proteine signifikante Unterschiede in den Konzentrationen zwischen den Geschlechtern bestehen. Dies deutet darauf hin, dass sich Männer und Frauen auf molekularer Ebene in ihrer Biologie stark unterscheiden.
Jedoch zeigte sich gleichzeitig, dass nur ein sehr kleiner Bruchteil – rund 100 Proteine – unterschiedliche genetische „Schalter“ besitzen, die ihre Expression geschlechtsspezifisch regulieren. Dieser Befund bedeutet, dass die genetische Steuerung der meisten Proteine grundsätzlich bei Männern und Frauen ähnlich funktioniert.Diese Erkenntnis hat weitreichende Bedeutung für die Medizin und insbesondere für die Entwicklung neuer Medikamente. Viele moderne Therapien zielen direkt auf Proteine ab, um Krankheiten effizient zu behandeln. Die Annahme, dass die genetische Kontrolle dieser Proteine bei beiden Geschlechtern vergleichbar ist, wird durch die Studie bestätigt.
Dennoch bleibt die Frage: Warum unterscheiden sich die Proteinlevel trotzdem so deutlich? Die Antwort liegt in der komplexen Wechselwirkung zwischen Genetik, Hormonen und nicht-genetischen Einflüssen. Hormone wie Östrogen und Testosteron spielen nach wie vor eine zentrale Rolle bei der Regulation zahlreicher biologischer Prozesse und können die Proteinkonzentrationen maßgeblich beeinflussen.Darüber hinaus weisen die Forscher darauf hin, dass soziale und Umweltfaktoren einen erheblichen Beitrag zu den beobachteten Geschlechterunterschieden leisten. Aspekte wie berufliche Belastung, Lebensumfeld, Bildung, finanzielle Ressourcen und Lebensstil wirken sich ebenfalls auf die Gesundheit aus und modulieren die Krankheitsrisiken und Symptomverläufe verschieden bei Männern und Frauen. Diese sozialökonomischen Faktoren sind oft unterschätzt, obwohl sie essentiell sind, um geschlechtsspezifische Unterschiede umfassend zu verstehen und in der Gesundheitsversorgung zu berücksichtigen.
Die Erkenntnisse dieser Studie verdeutlichen, dass eine erfolgreiche personalisierte Medizin das Geschlecht als wichtigen Faktor integrieren muss – nicht nur auf biologischer und genetischer Ebene, sondern auch in Hinblick auf individuelle Lebensumstände. Die Forscher betonen, dass traditionell geschlechtsspezifische Unterschiede im klinischen Alltag oft nur unzureichend berücksichtigt werden. Dies kann dazu führen, dass Diagnosen, Therapien und Präventionsmaßnahmen für das jeweils andere Geschlecht weniger effektiv oder gar ungeeignet sind.Die methodische Stärke der Untersuchung liegt in der groß angelegten Verwendung von Daten aus der UK Biobank, einem der weltweit größten populationsbasierten Kohortenstudien, die zahlreiche Gesundheitsparameter und genetische Informationen bündelt. Dank modernster Analysemethoden konnte das internationale Forschungsteam erstmals so detailliert die Interaktion zwischen Genen, Proteinen und Geschlecht erforschen.
Neben der genetischen Information wurde der biologische Status anhand der Chromosomen (XX oder XY) eindeutig zugeordnet, um wissenschaftlich präzise Vergleiche anzustellen. Die Forscher räumen jedoch ein, dass diese Einteilung das Spektrum menschlicher Geschlechtsidentitäten nicht abbilden kann.Mine Koprulu, die leitende Wissenschaftlerin der Studie, betont die Bedeutung des interdisziplinären Ansatzes: „Erstmals ist es uns gelungen, den Einfluss des biologischen Geschlechts auf die Regulation von Blutproteinen so detailliert zu untersuchen. Unsere Arbeit zeigt klar, dass genetische Faktoren nur einen Teil der Unterschiede erklären. Um die Gesundheit von Männern und Frauen besser zu verstehen, müssen wir deshalb auch soziale und ökologische Einflüsse stärker berücksichtigen.
“ Professor Claudia Langenberg, Direktorin des Precision Healthcare Institute und Mitautorin der Studie, fügt hinzu, dass die Ergebnisse auch für die zukünftige Entwicklung von Medikamenten von großer Bedeutung sind. „Die Medikamentenentwicklung profitiert enorm davon, wenn sie geschlechterspezifische Regulierungsmuster von Proteinen berücksichtigt. Unsere Daten bestätigen, dass die meisten genetischen Varianten ähnlich wirken – was bedeutet, dass viele therapeutische Erkenntnisse für beide Geschlechter gelten. Doch die weniger offensichtlichen Faktoren verdienen ein größeres Augenmerk, um eine wirklich individuelle Therapie zu ermöglichen.“Diese Forschungsarbeit hat weitreichende Implikationen für die klinische Praxis.
Zum einen unterstreicht sie die Notwendigkeit, geschlechtsspezifische Unterschiede in medizinischen Studien systematisch zu erfassen und auszuwerten. Zum anderen fordert sie eine Erweiterung des Blickwinkels, um neben genetischen Determinanten auch Umwelt- und Lebensstilfaktoren sowie sozioökonomische Bedingungen in die Diagnostik und Behandlung von Patienten einzubeziehen. Nur so kann ein gerechter und wirksamer Zugang zur Gesundheitsversorgung für alle Geschlechter gewährleistet werden.Zukünftige Forschungen sollten daher nicht nur die genetischen Grundlagen weiter entschlüsseln, sondern auch den Einfluss von Hormonen, psychosozialen Faktoren und kulturellen Gegebenheiten untersuchen. Eine multidimensionale Analyse könnte helfen, Gesundheitsdisparitäten zwischen Männern und Frauen besser zu verstehen und entsprechende Gegenmaßnahmen zu entwickeln.