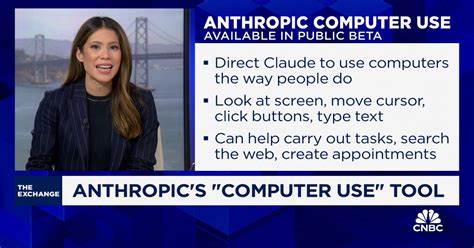Die politische Landschaft der Vereinigten Staaten hat in den letzten Jahren eine intensive und kontroverse Debatte darüber erlebt, ob Elemente des Faschismus in amerikanischen Bewegungen und Institutionen Fuß gefasst haben. Das Buch „Did it Happen Here? Perspectives on Fascism and America“, herausgegeben von Daniel Steinmetz-Jenkins, nimmt diese Diskussion in den Fokus und versucht, das hitzige „Faschismus-Debatte“ zu beenden – zumindest theoretisch. Doch das, was als akademische Auseinandersetzung begann, entwickelte sich rasch zu einem Spiegelbild der politischen Polarisierung und gesellschaftlichen Spannungen, die Amerika weiterhin prägen. Daniel Steinmetz-Jenkins, ein aufstrebender Geist im Bereich der Geschichts- und Sozialwissenschaften, studiert momentan unter der Anleitung von Samuel Moyn an der Columbia University. Sein Buch, das eine Sammlung verschiedener Essays enthält, hat eine klare Agenda: Die Frage, ob Trumpismus als Faschismus zu klassifizieren sei, soll mit Argumenten und historischen Bezügen endgültig geklärt werden.
Gerade in akademischen Kreisen fand das Werk starke Unterstützung, was zunächst den Eindruck erweckte, als sei der Streit über die Faschismus-Definition in den USA beinahe beendet. Dennoch zeigte sich bereits innerhalb eines Jahres ein Umbruch. Mit der zweiten Amtszeit von Donald Trump wurden einige Entscheidungen – wie die Abschiebung von Einwohnern ohne ordentlichen Rechtsprozess, umfassende Absetzungen in Bundesbehörden oder ideologisch motivierte Personalbesetzungen ohne Fachkompetenz – zum Katalysator für die härtere Kritik, wonach Trumpismus durchaus Faschismus sei. Bedeutende Historiker und Experten für Faschismus, darunter Robert Paxton, äußerten öffentlich, dass die Ereignisse rund um den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 (J6) tatsächlich faschistische Tendenzen offenbarten.
Ein interessanter Aspekt der Debatte ist die Zurückhaltung mancher prominenter linker Intellektueller, die das Label „Faschismus“ bis 2025 vehement ablehnten. Auch Samuel Moyn und Corey Robin zählten zu den Skeptikern und argumentierten, Trumpismus erfülle nicht alle historischen Kriterien des Faschismus. Diese Haltung basierte nicht nur auf inhaltlicher Kritik, sondern auch auf der Sorge um politische Konsequenzen eines solchen Begriffs. Moyn selbst erklärte, dass er sich wegen möglicher politischer Auswirkungen vor dem Gebrauch des Faschismus-Begriffs zurückhielt. Das bedeutet, dass die Frage nach dem Begriff selbst und dessen politischer Bedeutung eine zentrale Rolle in der Diskussion spielte, weit über die reine historische Definition hinaus.
Die intellektuelle Kontroverse wurde zusätzlich dadurch verschärft, dass einige Stimmen die Gefahr des Faschismus relativierten, um stattdessen liberale Kräfte als die bedeutendere Bedrohung darzustellen. Dabei argumentierten sie, dass der Kampf gegen den Faschismus letztlich von der Linken nicht ohne eine Allianz mit zentristischen Liberalen geführt werden könne, mit denen man traditionell oft im Dissens stand. Gerade diese Dynamik, bei der politische Kalküle und Ideologien mit historischen Fakten kollidierten, zeichnet die Debatte zentral aus. Die Zusammensetzung der Aufsätze in Steinmetz-Jenkins’ Buch zeigt die Vielfalt und zugleich die Spannungen innerhalb der akademischen Reflexion. Klassiker linker Analyse – von Leo Trotzki bis Angela Davis – werden neben zeitgenössischen Kommentaren platziert.
Auf der anderen Seite wird die Einordnung von Trumpismus als Faschismus, wie von einigen Autoren vertreten, eher marginal vertreten. Stattdessen finden sich Beiträge, die eher das liberale Establishment kritisieren als die rassistischen und autoritären Züge der Rechten hervorzuheben. Die Unsicherheit und Uneinigkeit führen zu der Frage, warum damals so viele linke und sozialistische Intellektuelle die faschistischen Merkmale in Trumpismus lange nicht anerkennen wollten. Die Antwort liegt nicht nur in methodischen Überlegungen, sondern im Spannungsfeld zwischen akademischer Analyse und parteipolitischer Strategie. Viele sahen in Trump vor allem eine Manifestation neoliberaler und kapitalistischer Probleme, die der linken Bewegung Gelegenheit bot, gegen das als verhasst empfundene liberale Establishment Stellung zu beziehen.
Eine klar benannte faschistische Gefahr hätte dieses Ziel konterkariert, da dies eine Zusammenarbeit mit etablierten anti-trumpistischen Kräften, wie etwa der Demokratischen Partei, erforderlich gemacht hätte. Diese Haltung brachte eine bemerkenswerte Haltung mit sich: Das Verweigern der Anerkennung von Trumpismus als Faschismus wurde politisch instrumentalisiert, um den eigenen marxistischen oder sozialistischen Positionen Raum zu verschaffen. Einige Stimmen innerhalb der Debatte äußerten sogar offen, dass es ihnen egal sei, ob Trump faschistisch sei, da ihre Priorität darin liege, den neoliberalen Kurs zu bekämpfen. Allerdings ist diese Position mit dem Risiko behaftet, dass man die realen Gefahren des aufkommenden Autoritarismus unterschätzt und gesellschaftlich zulässt. Die Frage, ob Präsident Trump und sein politischer Stil als Faschismus zu begreifen sind, ist also mehr als eine akademische Spitzfindigkeit.
Sie zeigt auf, wie politisches Denken, Ideologie und gesellschaftliche Interessen in komplexer Weise verzahnt sind und wie historische Begriffe gegenwärtige politische Konflikte prägen. Mit der eindeutigen Positionierung von Fachleuten wie Paxton und weiteren, die den Faschismus-Begriff auf Trumpismus anwenden, wurde diese Kontroverse zumindest teilweise beendet. Einige früher hartnäckige Skeptiker aus linken Kreisen änderten ihre Positionen ebenfalls und signalisierten, dass die Entwicklungen in den USA durchaus in die faschistische Kategorie fallen können. Doch andere, wie Daniel Steinmetz-Jenkins selbst, verbleiben weiterhin in einer skeptischen Haltung und kritisieren die fortwährende und „lästige“ Debatte als ermüdend und fruchtlos. Die Diskussion legt darüber hinaus nahe, wie schwierig die Balance zwischen objektiver Geschichtsschreibung und politischem Aktivismus sein kann.
Die Gefahr, dass politische Interessen die wissenschaftliche Analyse überlagern, ist nicht zu unterschätzen. Dabei handelt es sich keineswegs nur um akademische Streitigkeiten, sondern um Fragen, die tief in die demokratische Kultur und die Zukunft der Vereinigten Staaten hineinwirken. Gerade im Zeitalter digitaler Medien und sozialer Netzwerke ist die Rolle von Intellektuellen und Wissenschaftlern wichtiger denn je. Ihre Einschätzungen bilden die Grundlage für ein öffentliches Verständnis von Demokratie, Autoritarismus und den Grenzen zwischen verschiedenen politischen Systemen. Das Buch „Did it Happen Here?“ und die begleitende Debatte verdeutlichen, wie komplex und vielschichtig die Definition von Faschismus in der heutigen politischen Landschaft ist.
Es fordert dazu heraus, präzise zu arbeiten, politische Absichten offen zu legen und vor allem die historischen Lehren ernst zu nehmen. Letztlich steht der Diskurs über Faschismus in Amerika für eine grundsätzliche Frage: Wie erkennt und reagiert eine demokratische Gesellschaft auf Bedrohungen ihrer Werte und Strukturen? Sind klare Begriffe und Benennungen notwendig, um Warnungen auszusprechen – oder können politische Opportunismen die Gefahr verschleiern? Der offene Diskurs und die kritische Auseinandersetzung sind somit ein notwendiger Bestandteil des demokratischen Prozesses. Nur so kann verhindert werden, dass „die Wölfe“, metaphorisch für den Faschismus, in der Gesellschaft unbemerkt Einzug halten. Die Beobachtungen und Analysen von Richard Steigmann-Gall und weiteren Historikern zeigen auf, wie sorgfältiges akademisches Arbeiten die öffentlichen Debatten bereichern kann. Gleichzeitig mahnen sie zur Wachsamkeit gegenüber ideologischen Verzerrungen und politischen Instrumentalisierungen.
Gerade in Zeiten wachsender Spannungen in den USA bleibt es unerlässlich, dass Geschichte, Politik und Gesellschaft in einem ehrlichen, ungeschminkten Dialog zusammenwirken, um gemeinsame Herausforderungen zu meistern.
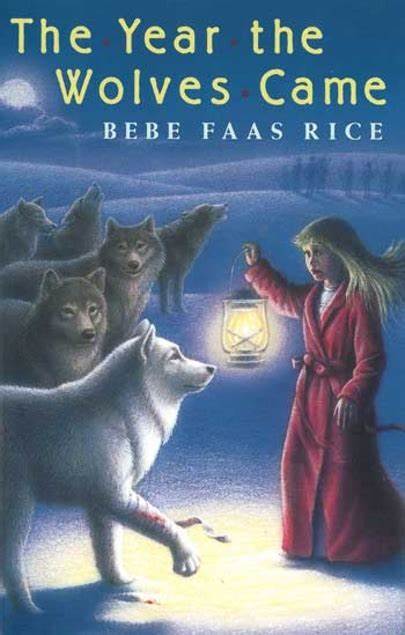



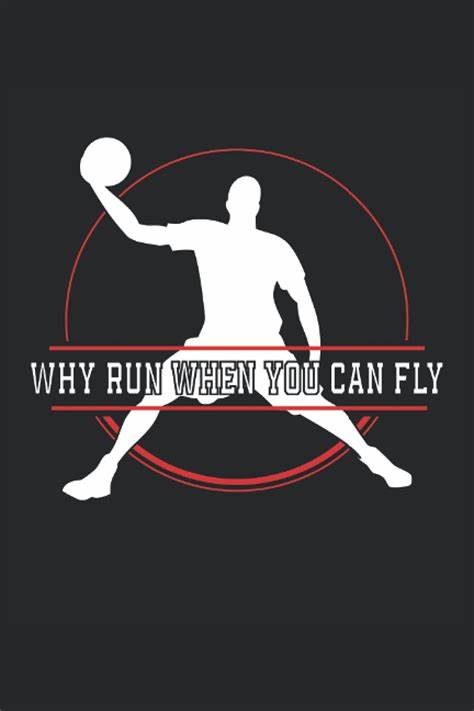
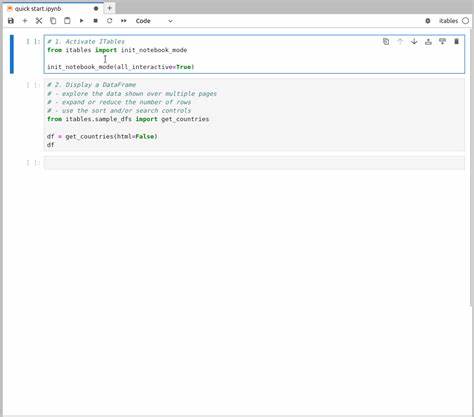
![The New Amazon Robot That Can Feel What It Touches [video]](/images/D55C4AE5-9BB3-4CE0-B82D-03E06176881D)