In der Welt der technischen Kommunikation ist es oft die Aufgabe technischer Autoren, Informationen präzise, klar und verständlich aufzubereiten. Dabei werden sie häufig als neutrale Vermittler wahrgenommen, die Inhalte lediglich weitergeben, sprachlich verfeinern und publizieren. Doch diese zurückhaltende Rolle greift zu kurz und schadet nicht nur der Qualität der Dokumentation, sondern letztlich auch den Unternehmen, für die sie arbeiten. Es geht vielmehr darum, kritisch zu sein, Missstände offen anzusprechen und so zur Wahrheitsfindung beizutragen. Das Mutigsein und das klare Benennen von „Bullshit“ sind Fähigkeiten, die in der technischen Kommunikation unverzichtbar sind.
Der Ursprung Wissen entsteht nicht isoliert. Wissen ist sozial konstruiert und entwickelt sich durch Austausch, Diskussion und kritische Überprüfung verschiedener Perspektiven. Dieses Konzept beschreibt Jonathan Rauch in seinem Buch "The Constitution of Knowledge" eindrucksvoll. Er stellt dar, wie gesellschaftliche Institutionen strukturiert sind, um einen Prozess der Überprüfung und Auseinandersetzung zu ermöglichen, der kollektive Erkenntnisse hervorbringt. In technischen Kontexten übertragen bedeutet dies, dass einzelne Meinungen oder Ideen nur dann Bestand haben, wenn sie kritisch geprüft und innerhalb des Teams oder der Gemeinschaft hinterfragt werden.
Für technische Autoren bedeutet das, nicht nur Fakten korrekt wiederzugeben, sondern auch problematische Inhalte zu hinterfragen. Intuition und ein inneres „Warnsignal“ spielen dabei eine zentrale Rolle. Oftmals signalisiert der Bauch oder das Unterbewusstsein, wenn ein Begriff, eine Formulierung oder ein Konzept unpassend oder irreführend ist – auch wenn die genauen Gründe zunächst schwer zu benennen sind. Dieses Gefühl gilt es wahrzunehmen, zu reflektieren und gegebenenfalls zum Anlass zu nehmen, kritische Nachfragen zu stellen. Nicht immer ist es leicht, auf Fehlentwicklungen oder Unklarheiten hinzuweisen.
In Teams oder größeren Gruppen kann es unangenehm sein, widersprechend aufzutreten. Die Angst vor Ablehnung, Konflikten oder gar möglicher sozialer Isolation hält viele zurück. Zugleich besteht die Gefahr, dass durch Schweigen fehlerhafte Informationen oder schlechte Entscheidungen ungehindert ihren Weg finden. Die Konsequenzen können signifikant sein – von Nutzerirritation und falschen Erwartungen bis hin zu gravierenden Auswirkungen auf die Produktqualität und die Glaubwürdigkeit des Unternehmens. Das aktive Einbringen kritischer Stimmen wird somit zur ethischen Verantwortung technischer Autoren.
Sie dienen als eine Art Qualitätsfilter, der nicht nur die sprachliche Korrektheit, sondern auch den inhaltlichen Sachverstand sichert. Die Rolle des „stillen Mitläufers“ wird verlassen, gelebte Meinungsvielfalt erfordert Mut und Durchsetzungsvermögen. Kommunikation auf Augenhöhe und respektvolle Konfliktkultur helfen dabei, dass auch heikle Themen besprechbar bleiben, ohne persönliche Fronten zu errichten. Eine bewährte Strategie, wenn direkte Konfrontation schwierig erscheint, sind offene und klärende Fragen. Anstatt Vorwürfe zu erheben, kann man mit ehrlichem Interesse danach fragen, warum bestimmte Entscheidungen getroffen wurden oder ob es andere Alternativen gab.
Diese Herangehensweise schafft Raum für gemeinsame Exploration und verringert Widerstände. Eine sachliche, neugierige Haltung ist daher oft effektiver, um Fehler aufzudecken und Diskussionen zu eröffnen. Die Fähigkeit, den inneren Kritiker zu aktivieren und gleichzeitig empathisch zu kommunizieren, ist nicht jedem naturgegeben. Sie lässt sich jedoch trainieren und stärken. In der Praxis empfiehlt es sich, regelmäßig innezuhalten, die eigene Unsicherheit ernst zu nehmen und vorsichtig nachzufragen.
Das „Warnsignal“ ernst zu nehmen, heißt auch, eigene Zweifel nicht wegzudrücken oder zu verdrängen. Respektvolles Nachhaken schlägt eine Brücke zwischen Zweifel und Verständnis. Zudem ist es hilfreich, sich vor Augen zu halten, dass unterschiedliche Perspektiven zur Wissensgenerierung beitragen. Wenn Menschen aktiv widersprechen und argumentativ überzeugen, entsteht ein robusteres, fundierteres Modell der Realität. Schweigen hingegen begünstigt das Verharren in Irrtümern.
Daher liegt im kollegialen, offenen Diskurs der Schlüssel zum Fortschritt und zur Qualitätssicherung. Technische Autoren können sich zudem als „Erste Nutzer“ eines Produkts oder Systems begreifen. Ihre Scheu, Kritik zu äußern, weil sie nicht alle Details kennen oder Entscheidungen nicht selbst getroffen haben, ist verständlich, darf aber nicht zur Passivität führen. Durch ihre Nähe zur technischen Dokumentation haben sie oft eine einzigartige Sichtweise, die ihnen ermöglicht, Probleme aus Nutzersicht zu erkennen und zu thematisieren. Ihre Aufgabe ist es, diese Erkenntnisse zu kommunizieren und dabei auch unpopuläre Standpunkte einzunehmen, wenn der Sachverhalt es verlangt.
Ein weiterer Aspekt betrifft die Angst vor Ablehnung, die sich generationenübergreifend beobachten lässt. Schon junge Menschen zeigen oft Zurückhaltung, wenn es darum geht, Autoritäten zu widersprechen oder unbequeme Fragen zu stellen. In Organisationen spiegelt sich dieses Verhalten in einem starken Harmoniebedürfnis wider, das unliebsame Diskussionen vermeidet. Technische Kommunikation profitiert jedoch von einer Kultur, die beharrliches Nachfragen und kritisches Hinterfragen fördert – eine Kultur, die Fehler als Lernchancen anerkennt und nicht als Makel betrachtet. Wie gelingt es also, das innere Warnsignal bewusst wahrzunehmen? Das Erlernen von Achtsamkeit für diese subtilen Hinweise ist ein Prozess, der ähnlich funktioniert wie intuitive Ernährung: Statt auf äußere Regeln zu vertrauen, nimmt man seine eigenen Bedürfnisse und Signale wahr und handelt danach.
Im Schreibprozess bedeutet das, sensibel für sprachliche und inhaltliche Ungereimtheiten zu sein, diese zu hinterfragen und nicht einfach zu übergehen. Das bewusste Zuhören auf das eigene Empfinden unterstützt die Entwicklung von gutem Urteilsvermögen und schärft die fachliche Kompetenz. Die Bedeutung dieser Haltung zeigt sich auch darin, dass stille Zustimmung nicht automatisch tatsächliches Einverständnis bedeutet. Wenn niemand widerspricht, wird womöglich ein falscher Eindruck von Konsens erzeugt. Dies kann Fehlentscheidungen begünstigen und dazu führen, dass suboptimale Lösungen implementiert werden.
Technische Autoren tragen daher einen wichtigen Beitrag dazu bei, solche Schein-Konsense aufzubrechen und einen konstruktiven Meinungsstreit zu ermöglichen. Beim Aufzeigen von Missständen oder problematischen Inhalten ist Fingerspitzengefühl gefragt. Es geht nicht darum, Personen anzugreifen oder Fronten zu schaffen, sondern um die gemeinsame Suche nach der besten Lösung. Die Kunst besteht darin, klare, unbequeme Wahrheiten anzusprechen und gleichzeitig die Professionalität und den Respekt im Gespräch zu wahren. Dabei können gezielte Rückfragen helfen, die eigene Einschätzung zu validieren und das Gegenüber zu überzeugen.
In Zeiten von Fake News, Desinformation und Schnelllebigkeit gewinnt die Fähigkeit, Bullshit zu erkennen und zu entlarven, an Bedeutung. Technische Autoren stehen in der Verantwortung, durch sorgfältige Recherche, kritisches Denken und Mut zum Widerspruch zur Wahrheitsfindung beizutragen. Ihre Arbeit wirkt sich direkt auf die Glaubwürdigkeit von Unternehmen und Produkten aus. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das aktive Sprechen gegen Unsinn und problematische Ideen ein essenzielles Element der technischen Kommunikation ist. Die Bereitschaft, innere Warnsignale zu hören, auch unbequeme Fragen zu stellen und sich für den Wahrheitsgehalt einzusetzen, sichert eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit der Arbeit.
Mut zur kritischen Stimme, gepaart mit einem konstruktiven und respektvollen Umgang, schafft eine Kultur des Vertrauens, die langfristig Erfolge gewährleistet. Wer sich als technischer Autor in diese Rolle begibt, unterstützt nicht nur seine Teams und Organisationen, sondern trägt auch zur Stärkung einer fundierten, kollaborativen Wissensgesellschaft bei. Das Aufdecken von Bullshit ist somit kein Störfaktor, sondern ein Motor für Weiterentwicklung und Wahrheitssuche – etwas, das in jedem professionellen Umfeld geschätzt und gefördert werden sollte.



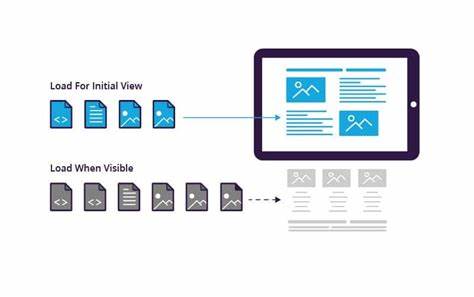


![Flight Simulator 2 – Amiga 500 [video]](/images/CE339B2D-0B1C-41A9-9616-B6D7AD086FE5)


![A US Clothing Brand on the Existential Threat from the Tariffs [audio]](/images/6A1B8745-8362-4257-AE77-7A3AB71DE2B0)