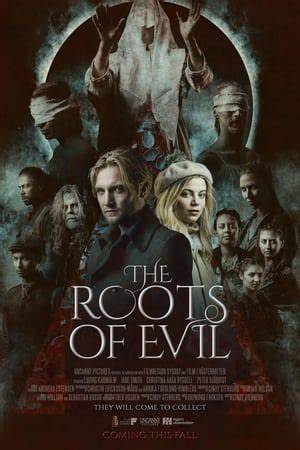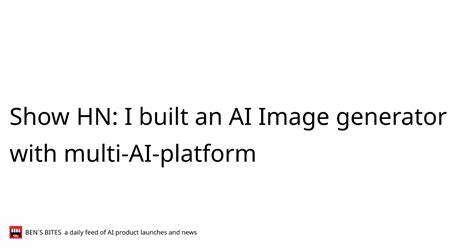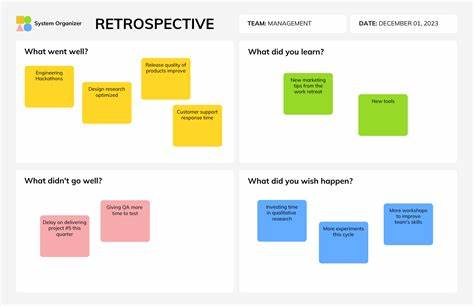In vielerlei Diskussionen wird immer wieder behauptet, dass Geld die Wurzel allen Übels sei. Dieses alte Sprichwort hat sich fest im gesellschaftlichen Bewusstsein verankert, doch bei näherer Betrachtung erweist sich diese Aussage als problematisch und vereinfacht die komplexen Beweggründe für moralisch verwerfliches Verhalten. Geld an sich ist nichts anderes als ein Tauschmittel, eine Erfindung, die den Handel und die Kooperation in großen Gesellschaften erleichtert. Es dient dazu, Waren und Dienstleistungen zu bewerten und auszutauschen und ermöglicht so eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Ohne Geld wäre das regelmäßige Zusammenleben und Arbeiten in hochentwickelten Gesellschaften schwer denkbar.
Doch wenn Geld an sich nicht das Übel ist, was sind dann die eigentlichen Wurzeln des Bösen? Die Antwort liegt in den menschlichen Motiven und sozialen Strukturen, insbesondere im Streben nach Macht und Status. Geld wird oftmals mit Gier gleichgesetzt, doch die Motivationen für böses Handeln gehen weit darüber hinaus. Viele Verbrechen und Grausamkeiten entstehen nicht aus der Gier nach Reichtum, sondern aus Eifersucht, Rachsucht, ideologischer Überzeugung oder dem Wunsch nach sozialer Überlegenheit. Die Geschichte liefert zahlreiche Beispiele: Serienmörder wie Ted Bundy handelten aus sadistischen Motiven, Diktatoren wie Hitler und Stalin verübten Massenmorde aus Hass und Machterhalt, nicht um Geld zu verdienen. Intriguen und politische Verfolgungen zeigen, dass das Verlangen nach sozialer Dominanz oft die treibende Kraft hinter zerstörerischen Handlungen ist.
Im Gegenteil: Geld ist häufig der Antrieb hinter positiver sozialer Aktivität. Landwirte bauen Nahrung an, Ärzte heilen Kranke, Handwerker schaffen Produkte – all das geschieht selten nur aus reiner Nächstenliebe, sondern meist auch aus wirtschaftlichen Gründen. Gerade das Zusammenwirken von individuellem Nutzen und gesellschaftlichem Fortschritt macht Geld zu einem positiven Faktor. Der Handel erweitert den gesellschaftlichen Wohlstand und fördert Kooperation und Innovation. Im Gegensatz dazu ist Status ein nullsummiges Gut, was bedeutet, dass ein Zugewinn an Status für eine Person zwangsläufig einen Verlust für eine andere bedeutet.
Status beruht auf dem Vergleich mit anderen – niemand kann gleichzeitig an den sozialen Hierarchien aufsteigen, ohne dass andere zurückfallen. Dieses Streben ist tief in der menschlichen Psyche verankert, weil es in der evolutionären Vergangenheit direkten Einfluss auf Überleben und Fortpflanzung hatte. Wer in der sozialen Rangordnung höher stand, hatte bessere Chancen auf Ressourcen und Partner. Auch heute noch ist Status eng mit sozialem Einfluss und Attraktivität verknüpft. Die Jagd nach Status birgt jedoch erhebliche Gefahren für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das individuelle Verhalten.
Weil es immer nur eine begrenzte Anzahl hochrangiger Positionen gibt, liegt ein gewisser Konkurrenzkampf nahe, der sich auch in Rivalität, Intrigen oder sozialer Ausgrenzung manifestiert. Nicht selten führt der Wunsch nach Status dazu, dass Menschen unehrlich handeln, andere schlechtmachen oder destruktive Gruppendynamiken fördern – beispielsweise in Form von Mobbing oder öffentlicher Anprangerung. Besonders in sozialen Medien lässt sich beobachten, wie dieses Verhalten eskaliert und zur Verrohung der öffentlichen Debatte beiträgt. Dieser Statuswettstreit ist also teils inhärent asozial und zieht sogar Personen mit aggressiven oder eigennützigen Charakterzügen an. Während das Streben nach materiellen Gütern oft mit rechtlichen und moralischen Grenzen konfrontiert ist, zeigen sich bei Status auch subtilere und rarer sanktionierte Formen von Missbrauch und Manipulation.
Das macht es so schwierig, mit gesellschaftlichen Mitteln gegenzusteuern. Noch destruktiver wird es beim Machtstreben. Macht ist eng mit Status verbunden, aber besonders deshalb problematisch, weil sie mit einer klaren Dominanz anderer einhergeht und negative soziale Auswirkungen nach sich zieht. Machtversuche basieren darauf, dass die Macht des Einen mit einer Machtlosigkeit vieler anderer einhergeht. Menschen schätzen ihre Autonomie und Kontrolle über das eigene Leben als zentral ein, weshalb die Entmachtung besonders schmerzlich ist und dadurch netto einen kulturellen und sozialen Verlust bedeutet.
Macht wird oft mit Gewalt, Unterdrückung und Ausbeutung assoziiert, weil sie über das Recht oder die Fähigkeit verfügt, anderen Schaden zuzufügen oder ihre Freiheit einzuschränken. Machteifer findet sich in Kriegen, in Unterdrückungsregimen und in alltäglichen Machtkämpfen zwischen Individuen oder Gruppen. Oft zeigt sich Machtausübung in Form von Drohungen, Erniedrigung oder offener Gewalt. Der Psychologe George Orwell brachte die bedrohliche Natur von Macht auf den Punkt, als er beschrieb, wie die Absicht, Macht zu besitzen, mit dem Wunsch zusammenfällt, Leid und Kontrolle zugleich auszuüben. Dabei gewinnt Macht über andere häufig erst dann an Bedeutung, wenn sie mit der Fähigkeit verbunden ist, diesen Leid zuzufügen oder ihnen die Autonomie zu nehmen.
Die Suche nach Macht ist demnach nicht nur ein nullsummiges Spiel, sondern meist sogar ein negatives. Der Gewinn von Macht auf Seiten eines Menschen geht mit dem Verlust von Freiheit und oft auch Leben anderer Menschen einher. Im Gegensatz zu Geld, das häufig wohlwollend erwirtschaftet werden kann, ist Macht oft mit sozialer Zerstörung verbunden und führt häufig zu großem menschlichem Leid. In der Gesellschaft wird die Bedeutung von Geld, Macht und Status auch durch soziale Narrative geprägt. Warum hat sich gerade das Geld als „die Wurzel allen Übels“ etabliert, während der Zusammenhang mit Macht und Status weniger offen diskutiert wird? Ein entscheidender Grund liegt in den Interessen der kulturellen Eliten, jenen gesellschaftlichen Gruppen, die Meinungen prägen und verbreiten.
Viele Vertreter dieser Eliten sind selbst stark am Streben nach Status und Macht interessiert, während ihre persönlichen Ambitionen in Bezug auf finanziellen Reichtum vergleichsweise gering sind. Akademiker, Politiker, Journalisten und andere Intellektuelle befinden sich oft in hoher gesellschaftlicher Stellung, verfügen aber nicht unbedingt über ein hohes Vermögen. Da es für diese Gruppen unangenehm wäre, das Streben nach Macht oder Status zu kritisieren – da sie meist in diesen Hierarchien selbst verankert sind oder gar den Staat als Machtinstrument befürworten – liegt es nahe, die Kritik auf den Reichtum umzulenken. So wird das Geld zum Sündenbock erklärt, während die wahren, weil tiefer sozialen und psychologischen Antriebskräfte von Bösem verschleiert werden. Dieses verschobene Augenmerk führt leider dazu, dass viele Probleme der Gesellschaft, die mit Machtmissbrauch und zerstörerischen Statuskämpfen zu tun haben, nicht angemessen erkannt oder bekämpft werden.
Das Streben nach Geld kann über positive Anreize gesellschaftlichen Fortschritt fördern, während der Kampf um Macht und Status häufig destruktive Folgen nach sich zieht. Um gesellschaftliche Übel wirklich zu bekämpfen, bedarf es daher eines bewussten Blicks auf diese tiefer liegenden Motive. Zusammengefasst zeigt die Betrachtung, dass Geld selbst nicht die Quelle des Bösen ist, sondern das Streben nach Macht und Status oft die eigentlichen Triebfedern für viele moralische Verfehlungen darstellen. Während Geld als Werkzeug für Austausch und Fortschritt dient, sind Macht und Status stark personenbezogene Phänomene, die zwangsläufig mit Konflikten und Schaden für andere einhergehen. Ein besseres Verständnis dieser Dynamiken kann dabei helfen, sozial verträglichere Formen des Zusammenlebens und des Einflussgewinns zu fördern, die weniger auf Zerwürfnissen und Unterdrückung basieren.
Es ist unerlässlich, gesellschaftliche Strukturen so zu gestalten, dass Machtmissbrauch erschwert und der Wettbewerb um Status weniger zerstörerisch wird. Nur wenn der Fokus verschoben wird und die tieferliegenden Ursachen des Bösen klar benannt und adressiert werden, lassen sich wirksame Lösungen finden, die langfristigen Frieden und Wohlstand ermöglichen. Indem wir das Streben nach Geld in seinem positiven Potential anerkennen und gleichzeitig den problematischen Macht- und Statuswettbewerb kritisch hinterfragen, können wir einen wichtigen Schritt hin zu einer gerechteren und menschlicheren Gesellschaft machen.