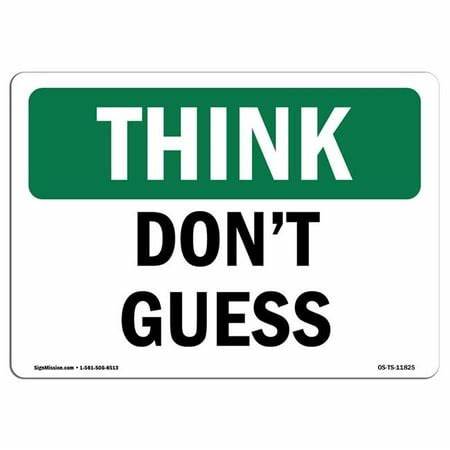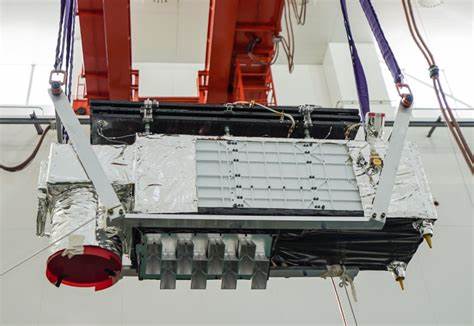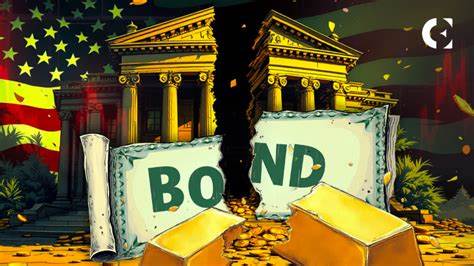Die Marsoberfläche fasziniert Wissenschaftler und Technik-Enthusiasten weltweit seit Jahrzehnten. Besonders auffällig sind dabei die sogenannten Hangstreifen oder Slope Streaks, die sich über hunderte Meter an steilen Hängen und Kratern entlangziehen. Lange Zeit wurde angenommen, sie könnten ein Zeichen fließenden Wassers auf dem Mars sein – ein Hinweis darauf, dass das rote Wüstenplanet möglicherweise doch heute noch in versteckten Nischen lebensfreundlich sein könnte. Doch eine aktuelle Studie von Forschern der Brown University und der Universität Bern stellt diese Annahme nun in Frage. Durch die Anwendung modernster maschineller Lernmethoden haben die Wissenschaftler einen großflächigen Datensatz von über einer halben Million dieser Streifen analysiert und haben deutliche Hinweise darauf gefunden, dass sie durch trockene Abläufe wie Staublawinen ausgelöst werden – nicht durch Wasser.
Die Entdeckung dieser dunklen, fingerartigen Streifen geht zurück bis zu den ersten Marsbildern der Viking-Mission in den 1970er Jahren. Seither haben Wissenschaftler sie studiert, um Hinweise auf aktuelle geologische und womöglich biologische Prozesse zu finden. Die Streifen sind meist dunkler als das umliegende Gelände und verlaufen entlang steiler Hänge in Gebieten wie Arabian Terra. Einige dieser Streifen bleiben über Jahre oder sogar Jahrzehnte sichtbar, andere treten nur während bestimmter Jahreszeiten auf und verschwinden wieder, was ihnen den Namen „Recurring Slope Lineae“ (RSL) eingebracht hat. Für zahlreiche Jahre war eine gängige Hypothese, dass es sich bei diesen Streifen um Spuren von flüssigem Wasser handelt, das saisonal aus dem Untergrund oder aus eingeschlossenen Eisschichten austritt.
Dieses Wasser, angereichert mit Salzen zur Senkung des Gefrierpunkts, könnte selbst bei den extrem kalten Oberflächentemperaturen des Mars fließen und temporäre Lebensräume schaffen. Diese Vorstellung befeuerte Hoffnungen auf die Entdeckung von mikrobiologischem Leben und machte die Hangstreifen zu heiß begehrten Zielen zukünftiger Marsmissionen. Doch die Bedingungen auf dem Mars sind äußerst herausfordernd: Die Atmosphäre ist dünn, Temperaturen fallen oft weit unter den Gefrierpunkt, und Wasser in flüssiger Form ist unter normalen Bedingungen äußerst instabil. Auch zahlreiche Messungen und Missionen liefern bislang keine direkten Beweise für aktuell fließendes Wasser. Um die Entstehungsmechanismen der Hangstreifen besser zu verstehen, wählten die Forscher um Adomas Valantinas von der Brown University und Valentin Bickel von der Universität Bern einen datengetriebenen Ansatz.
Sie trainierten eine maschinelle Lern-Software mit bestätigten Daten zu Hangstreifen und analysierten danach mehr als 86.000 hochauflösende Satellitenbilder der Marsoberfläche. So entstand die bislang umfassendste globale Karte von über 500.000 Hangstreifen auf dem Mars. Diese umfangreiche Datengrundlage ermöglichte den Wissenschaftlern, verschiedene Umwelt- und Geofaktoren wie Temperatur, Windgeschwindigkeiten, Feuchtigkeitswerte und Gesteinsaktivitäten statistisch zu untersuchen und mit den Verteilungen der Streifen zu korrelieren.
Überraschenderweise zeigten die Ergebnisse, dass weder eine bestimmte Hangneigung noch Temperaturspitzen oder erhöhte Luftfeuchtigkeit systematisch mit der Entstehung der Streifen zusammenhängen. Vielmehr stand eine große Anzahl der Streifen in Zusammenhang mit erhöhten Winden und Staubablagerungen – Faktoren, die auf rein trockene Prozesse deuten. So entstehen die Streifen offenbar durch plötzliche Staublawinen, bei denen feinste Staubschichten von steilen Hängen abrutschen. Die Auslöser können vielfältig sein. In der Nähe von jüngeren Einschlagkratern könnten Erschütterungen Staub aufwirbeln und einen Hang abrutschen lassen.
In anderen Gebieten könnten Staubteufel oder kleine Felsstürze ähnliche Effekte hervorrufen. Da diese Abläufe trocken sind, wäre das beobachtete flüssigkeitsähnliche Verhalten in frühen Bildern eine optische Täuschung. Die Konsequenzen dieser Erkenntnisse für die Erforschung des Mars sind weitreichend. Zum einen reduzieren sie die Wahrscheinlichkeit, dass an Hangstreifen heute noch flüssiges Wasser und somit potenzielle Lebensräume existieren. Waren solche Zonen bisher als mögliche „Hotspots“ für Leben oder zum Beispiel für die Suche nach biologischen Spuren interessant, zeigt die Studie, dass dort wohl keine besondere Umgebungsbedingung vorherrscht.
Zum anderen bedeutet dies, dass zukünftige Missionen die sogenannten Kontaminationen mit irdischen Mikroorganismen an diesen Orten weitaus weniger fürchten müssen. Dies ist ein wichtiger Aspekt, denn die Angst, Marsmissionen könnten fremde Lebensformen auf dem Mars einschleppen und somit die lebensgeschichtliche Suche verfälschen oder gar unwiederbringlich beeinträchtigen, wurde bisher vielfach diskutiert. Wenn Hangstreifen kein flüssiges Wasser beherbergen, sinkt auch das Risiko der Kontamination drastisch. Außerdem unterstreicht die Arbeit die Bedeutung moderner Analysetechnologien wie des maschinellen Lernens in den Planetawissenschaften. Die Fähigkeit, riesige Datenmengen automatisch zu verarbeiten und wissenschaftliche Hypothesen auf Basis umfassender statistischer Auswertungen zu prüfen, ermöglicht eine objektivere und genauere Einschätzung komplexer Phänomene.
Diese Studie ist zudem eine Mahnung, wie vorsichtig Wissenschaftler bei der Interpretation ferngesteuerter Daten sein müssen. Insbesondere bei Planeten wie dem Mars, deren Untersuchung teuer und technisch herausfordernd ist, kann eine Fehlinterpretation von Erscheinungen zu Trugschlüssen und falschen Erwartungen führen. So zwingt uns die Entdeckung trockener Entstehungsmechanismen von Hangstreifen dazu, unsere Vorstellungen vom heutigen Marsklima und den dortigen geologischen Prozessen zu überdenken. Während die Suche nach Lebenszeichen auf dem Mars damit noch schwieriger wird, eröffnet die Betonung der Rolle von Staub und Wind auch neue Forschungsfelder. Denn diese Prozesse tragen nicht nur zur Gestaltung der Oberfläche bei, sondern beeinflussen auch die Marsatmosphäre und damit langfristig das Klimageschehen auf dem Planeten.
Millionen Tonnen Staub werden jährlich bewegt – ein Faktor, der möglicherweise das marsspezifische Wetter und Temperaturprofile mitprägt. Darüber hinaus lenkt die Erkenntnis den Blick auf andere geologische Merkmale und Phänomene, die künftig genauer unter die Lupe genommen werden müssen, um die Marsgeschichte besser zu verstehen. Beispielsweise könnten Eisvorkommen unter der Oberfläche oder alte, fossile Flussläufe weiterhin Hinweise auf eine einmal wasserreiche Vergangenheit liefern, auch wenn heute flüssiges Wasser keine Rolle mehr spielt. Zukünftige Missionen wie der Mars Sample Return oder neue Rover, die speziell für die Untersuchung von Staub- und Klimaprozessen konzipiert sind, werden entscheidend sein, um das Bild zu vervollständigen. Doch schon heute liefert die vorliegende Untersuchung einen wichtigen Baustein für das Verständnis der Dynamik des Roten Planeten.
Abschließend lässt sich sagen, dass die faszinierenden Streifen an den Hängen des Mars weniger von wasserbasierten Sichtweisen geprägt sind, sondern vor allem das Ergebnis eines trockenen, vielfältigen Zusammenspiels von Staub, Wind und geologischen Einflüssen darstellen. Die Marsforschung gewinnt dadurch an Präzision und Klarheit und lenkt die Aufmerksamkeit auf die komplexen Prozesse, die auch ohne Wasser den Planeten formen und bewegen.